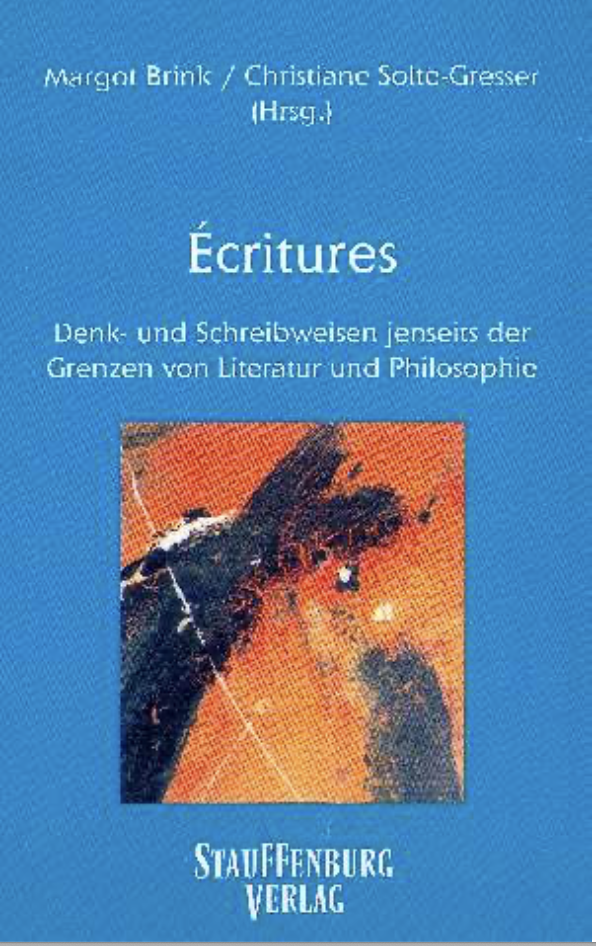Die Materialität der Sprache und warum ihr die Philosophie nicht entkommt
Merleau-Ponty und Wittgenstein
In: Margot Brink und Christane Sollte-Gresser (Hg.): Écritures. Denk- und Schreibweisen jenseits der Grenzen von Literatur und Philosophie. Stauffenburg Verlag, Tübingen 2004, S. 195-213.
Abstract
Die Philosophie ist geprägt durch ein Bild von der Sprache als mehr oder minder transparentem Medium, das den Blick des Geistes stärker oder schwächer beeinträchtigt?
Dieses Bild suggeriert, dass das Denken umso klarer wird, je mehr es ihm gelingt, sich der Sprache zu entledigen, sprachliche Qualitäten und Eigentümlichkeiten zu neutralisieren. Ist diese Gegenüberstellung aber so überzeugend wie sie vielen Philosophen scheint? Ist nicht gerade das Umgekehrte anzunehmen: dass eine Formulierung dann an Präzision gewinnt, wenn sie die Qualitäten der Sprache aufnimmt, die Mannigfaltigkeit der sprachlichen Momente einrichtet auf einen Sinn, der zum Ausdruck gebracht werden soll? Müssen Achtsamkeit, Feingefühl und Gespür für Sprache sich zwangsläufig auf die Sprache zurück wenden, so dass sie sich bloß in sich selbst spiegelt? Oder steht nicht genau dann, wenn ein sprachlicher Akt gelingt, der ganze Reichtum der Sprache auch hinter der schlichtesten Formulierung?
Um diesen Fragen nachzugehen, gilt es zunächst einmal zu klären, was es heißt, von einer Materialität der Sprache zu sprechen. Und dazu muss allererst deutlich werden, was mit Materialität überhaupt gemeint ist.
Merleau-Pontys Prosa der Welt ist über weite Strecken eine Auseinandersetzung mit Sartres Überlegungen aus Qu’est-ce que la littérature? Die Auffassung, gegen die sich Merleau-Ponty richtet, charakterisiert er wie folgt: „Es gibt keine eigene Kraft der Sprache, kein Vermögen liegt verborgen in ihr. Sie ist ein reines Zeichen für eine reine Bedeutung. Wer spricht, der chiffriert seine Gedanken” (Merleau-Ponty: 1993, 30). Tatsächlich findet sich in Sartres Ausführungen zur Lektüre ein Moment, das diesem Gegenmodell einer universellen Sprache der Dinge oder Gedanken verpflichtet bleibt: „So ist von Anfang an der Sinn nicht mehr in den Wörtern enthalten, weil er es vielmehr ist, der es ermöglicht, die Bedeutung eines jeden von ihnen zu verstehen; und obwohl sich der literarische Gegenstand über die Sprache realisiert, ist er doch niemals in der Sprache gegeben; er ist im Gegenteil seiner Natur nach Schweigen und Anfechtung des Redens.“ (Sartre: 1981, 39f).
Wir finden hier bei Sartre Anklänge der später bei Davidson postulierten Idee, dass es eine Kommunikation von Sinn über die Sprache hinweg gebe. Sartre macht dies an dem Phänomen fest, dass in der Aktivität des Lesers der „Gegenstand” der Lektüre „‚fängt’ (so wie man sagt, dass etwas Feuer fängt oder nicht)” (Sartre: 1981, 39), und selbst wenn Sartre später darauf zu sprechen kommt, wie die Worte in der Lektüre affizieren, so ist in diesen Affekten die Materialität der Sprache doch immer schon transzendiert (vgl. Sartre: 1981, 41).
Diese Überlegungen reformuliert nun Merlau-Ponty in folgender Weise (ich zitiere zentrale Sätze der Passage in loser Folge und einen zusammenhängenden Abschnitt, an dem Merlau-Pontys sprachliche Arbeit sichtbar wird)[1]:
Leseprobe
Sartres Unterscheidung von Poesie und Prosa liegt eine wichtige Beobachtung zugrunde. Tatsächlich bewegt sich der Umgang mit Sprache zwischen zwei extremen Polen: die Aufmerksamkeit kann entweder auf jeder Nuance des Wortes, des Klanges, des Satzbaus und -rhythmus etc. liegen und sie in ihrer dinglichen Eigenständigkeit erforschen (vgl. Sartre: 1981, 16ff.) oder aber die Wörter können als „nützliche Konventionen” und „Werkzeuge” (Sartre: 1981, 17) gebraucht werden, die für einen bestimmten Zweck eingesetzt werden (vgl. Sartre: 1981, 25). Sich von einem Pol zum anderen bewegend findet eine Verlagerung der Aufmerksamkeit statt. Stehen auf der einen Seite die Qualitäten der sprachlichen Elemente selbst im Fokus des Interesses, so verlagert sich dieser auf dem Weg zum anderen Pol mehr und mehr auf das durch die Worte Gesagte, Gedachte, auf das, was durch sie getan wird. Mehr und mehr scheint das Denken durch die Sprache hindurch zu greifen auf etwas, das ‚hinter’ der Sprache liegt, das ergriffen werden muss, um Sprache und Wirklichkeit in Verbindung zu bringen. In diesem Bild ist unmittelbar einsichtig, warum Sartre für die Aufgabe des Engagements eine klare Prosa fordert, denn etwas zu enthüllen, etwas zu behaupten, etwas zu fordern ist gerade dadurch möglich, dass sich die Aufmerksamkeit auf das Was des Enthüllten, Gesagten, Geforderten richtet, ohne vom Wie abgelenkt zu sein. So setzt er einem kontemplativen Umgang eine Haltung der Praxis entgegen.
Für die Sprache entsteht so das bekannte Bild eines zweiseitigen Mediums: auf der Vorderseite ist Sprache Materie, dinghaft, sinnlich, körperlich; auf ihrer Rückseite eröffnet sie den Raum der Ideen und Bedeutungen. Gelänge es, die Sprache ganz in den Dienst der dahinter liegenden Ordnung zu stellen, so wäre sie ein Werkzeug des reinen Denkens und Handelns. In diesem Bild ist die Sprache also das, was verschwindet, sofern in ihr gedacht und gehandelt wird.
Bei genauerer Betrachtung allerdings verwirrt sich dieses Bild zusehends. Denn weder ist jener Mechanismus der Aufmerksamkeitsverschiebung der Sprache eigentümlich, noch wird letztlich deutlich, warum praktische Relevanz nur der ‚transparenten’ Sprache zugeschrieben wird.
Schon der Hinweis darauf, wie die Poesie in der Sprache arbeitet, um deren Qualitäten wirksam werden zu lassen, macht deutlich, dass wir es auch hier mit einer Praxis zu tun haben, mit einem Tun, das gelingen und scheitern kann. Weiter ist zu bemerken, dass die Spannung zwischen einer materialbezogenen und einer zweckbezogenen Aktivität keine Besonderheit des sprachlichen Handelns ist, so dass gerade Sprache dadurch charakterisiert wäre, entweder material und unwirklich oder transparent und wirklichkeitsbezogen zu sein. Nicht nur Sprache, sondern auch Bilder, ja alle Medien zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich der Wahrnehmung entziehen und sichtbar machen, was in ihnen zur Aufführung kommt – solange sie funktionieren. Das wiederum verbindet sie mit den alltäglichsten Gegenständen und Verrichtungen. Wir vertrauen und bauen mit unbefragter Selbstverständlichkeit auf die Schmiegsamkeit und Fügsamkeit der Dinge, die erst durchbrochen wird, wenn die Dinge widerspenstig werden, wenn – wie in Döblins Märchen vom Materialismus – Zucker und Milch nicht mehr daran denken, sich im Kaffee zu lösen und zu mischen (Döblin: 1959, 42f.), wenn die beseelte Einheit von Materialien, Kenntnissen, Fertigkeiten und Erwartungen zerfällt und die Materialität in ihrer nackten Widerständigkeit uns entgegentritt.
Materialität kommt immer dann zum Vorschein, wenn die Dinge – wie Heidegger schreibt – sich in ihrer „Auffälligkeit, Aufdringlichkeit und Aufsässigkeit” (Heidegger: 1993, 74) zeigen, wenn sie unbrauchbar, fehlerhaft, unverfügbar oder hinderlich sind. Sie liegt offen zu Tage, wenn wir noch unbeholfen im Umgang mit etwas sind, noch keine Balance in den Routinen und Formulierungen gefunden haben. Und sie kehrt zurück in Momenten der Unsicherheit, wenn Situationen plötzlich anders sind als die uns vertrauten. Das macht deutlich, dass in der routinierten Praxis nur scheinbar die Materialität eliminiert ist, dass das Handeln nur vermeintlich sich in reiner Intention bewegt, dass das Stoffliche nicht ausgelöscht, sondern in Wohleingerichtetheit verschwunden ist.
Materialität ist nicht zu überwinden, nur zu überlisten. Selbst wenn es scheinbar nur auf die Funktion einer Sache ankommt, selbst wenn behauptet wird: ‚Hauptsache man kann in den Schuhen laufen’ – hat dies doch einen ganzen Komplex materialer Merkmale zur Voraussetzung: ist das Schuhwerk zu steif, zu schwer, zu brüchig, so kann es nicht einmal mehr seine elementare Funktion erfüllen, geschweige denn ihr dienlich sein. Die Dienstbarkeit des Materials resultiert hier nicht aus seiner Eliminierung, sondern aus der Raffinesse seiner Bearbeitung.
Die Suggestion, im Sprechen und Schreiben tatsächlich zu Sinn- und Ordnungsformen hinter der Sprache durchzustoßen, dürfte zum einen der naiven Auffassung von Materialität geschuldet sein. Solange Materialität nur auf der Ebene von Tintenspuren und Schallwellen lokalisiert wird, ist tatsächlich unplausibel, was sie mit dem Geschäft der Bedeutung anderes zu schaffen hat, als eine neutrale Ermöglichungsbedingung abzugeben. Zum anderen ist dieser Effekt aber auch darauf zurückzuführen, dass sprachliche Strukturen und Zwänge in einem bestimmten Sinn konventional sind, was es scheinbar leicht macht, ihren Eigensinn und ihre Widerständigkeit auf Absichten und Gedanken, also auf Geistiges und Rationales zurückzuführen. Um die damit einhergehende suggestive Verknüpfung von Sprache, Bedeutung und Vernunft zu unterlaufen, ist es hilfreich, einen Blick durch die formalistische und verfremdende Brille von Nelson Goodmans Symbolphilosophie auf diese Problematik zu werfen. Es zeigt sich dort eine ähnliche Dichotomie wie wir sie in Sartres Überlegungen vorgefunden haben, aber um eine entscheidende Wendung gedreht. Der Unterschied zwischen Poesie und Prosa erscheint hier nicht als der zwischen passiver Kontemplation und aktivem Engagement, sondern als der zwischen zwei Formen von Symbolsystemen.
Nach Goodmans Theorie (die ich hier in freizügiger Weise wiedergebe und verwende) gibt es zwei verschiedene Weisen, die Welt zu organisieren, sich in ihr zu situieren, zwei Typen von Symbolsystemen, zwei entgegensetzte Weisen sich zum Material in Beziehung zu setzen: Die eine richtet sich auf Genauigkeit, Eindeutigkeit und Übertragbarkeit; das alleinige Kriterium ist hier der möglichst präzise Gewinn und Transport von Information.
Interessiere ich mich beispielsweise nur für das Faktum der genauen Uhrzeit, dann ist mir gleichgültig, ob ich sie von einer Zeigerstellung oder von Ziffern ablese, ob sie visuell, elektromagnetisch oder akustisch übermittelt wird, ob die Information in der Bewegung von Zahnrädern oder von Quarzkristallen erzeugt wird – vorausgesetzt der Mechanismus funktioniert und lässt sich eindeutig ablesen. Die materielle Realisierung spielt hier keine Rolle ebenso wenig wie es eine Rolle spielt, ob die Noten, nach denen ein Stück zur Aufführung kommt, auf Papier, auf dem Bildschirm oder auf einem anderen Material geschrieben stehen. Die notationale Information – also nicht die je einzigartige Aufführung – ist in eindeutiger Weise formalisiert, gleichgültig ob sie auf Linien notiert oder in einem digitalen Medium gespeichert ist.
Es gibt also Symbolsysteme, die darauf zielen, eindeutige Werte zu erzeugen. Sie erreichen das durch das Prinzip der Zwischenräumlichkeit: ein f ist kein e und 12 Uhr 21, 4 Sekunden ist nicht 12 Uhr 21, 5 Sekunden. Der Preis ist, dass sie keine kontinuierlichen Übergänge – etwas lauter, ein wenig heller, eine Nuance verhaltener – repräsentieren können. Das ist für diese Systeme allerdings kein Schaden, sondern Voraussetzung ihrer Leistungsfähigkeit.
Das ist genau umgekehrt bei einem anderen Typ von Symbolsystemen, für die jeder Aspekt der materiellen Realisierung von Bedeutung ist. So ist – um ein Beispiel Goodmans aufzugreifen (vgl. Goodman: 1997, 212f) – in der Zeichnung des Fuji von Hokusei die exakte Liniengestalt und ihr Schwung ebenso entscheidend wie die Sättigung der Farbe, der Kontrast zum Hintergrund und die Qualität des Papiers. Keine Eigenschaft des Materials ist belanglos. Jede Änderung im Detail ist eine Änderung am Ganzen. Die Liniengestalt des Hokusei ist, was sie ist, weil sie, unter allen Möglichkeiten der Gestaltung, genau die Beschaffenheit hat, die sie hat. Ebenso ist das Wort „Florence” – in Hinblick auf seine materiale Qualität – nur dieser spezifische Dreiklang, weil es exakt so geschrieben ist, wie es ist. Wäre auch nur ein Buchstabe anders, wäre diese Komposition, die das Ganze ausmacht, zerstört. Zugleich könnte man natürlich eine der Linie des Fuji entsprechende Figur in einem physikalischen Diagramm finden und Florence kann sich angesprochen fühlen, auch ohne dass man Fluss, Gold und Dezenz anklingen spürt.
Die beiden Typen von Handlungs- und Symbolsystemen unterscheiden sich also nicht dadurch, dass sie Zeichen von unterschiedlicher äußerer Gestalt verwenden, sondern dadurch, dass im ersten Fall der notationalen Systeme Daten und Werte konventionell festgelegt und das Handeln – zumindest theoretisch – eindeutig geregelt ist. Im zweiten Fall dagegen lässt sich das Handeln vom Material leiten, vertieft sich in dessen Beschaffenheit, antwortet auf dessen Möglichkeiten. Die hier erforderliche Präzision ist nicht die eindeutiger Replikation und Übertragung, sondern eine der spezifischen Gradualität in Kontinua.
Die Unterscheidung der beiden Systemarten ist nicht nur theoretisch – denn tatsächlich lassen sich ja Beispiele anführen – sie markiert dennoch zwei extreme Formen, zwei Pole, zwischen denen sich fast alles, was getan wird, in unterschiedlichen Gewichtungen zwischen Konventions- und Materialbezogenheit abspielt.
Es gibt also tatsächlich Ordnungen des Handelns, für die – ohne dass sie dadurch in einen amaterialen, idealen Raum transzendierten – das Material weitgehend neutralisiert ist und seine Beschaffenheit nur insoweit von Belang, als sie es erlaubt, eindeutige Differenzen zu notieren. Die Frage ist nun aber, wie das sprachliche Handeln sich zum Sprachmaterial verhält und wie die Philosophie sich zu beiden, zu den konventional und material bestimmten Ordnungen verhält. Inwiefern kann man von einer Materialität der Sprache sprechen?
- Die Materialität der Sprache
Da das sprachliche Zeichen bekanntlich arbiträr ist, scheint die Sprache ganz dem ersten Typ von Symbolsystemen zuzufallen, also ein durch und durch konventionelles Gebilde zu sein. Doch wie bereits Saussure gezeigt hat, ist die Willkürlichkeit der Relation von Signifikant und Signifikat paradoxerweise damit verbunden, dass „das sprachliche Zeichen dem Einfluß unseres Willens entrückt ist” (Saussure: 1967, 83). Gerade dadurch, dass sie in der Zeit steht und in unzähligen Sprechakten unzähliger Akteure ständig in Gebrauch ist, liegt – so Saussure – ein Beharrungsvermögen, das die Sprache jedem planmäßigen Eingriff entzieht. Anders als Notationen und Signalsysteme ist die Sprache ein dynamisches Material, das eigenständige Strukturen ausbildet und sich verändert, aber durch keine Macht der Welt letztlich zu kontrollieren ist. Im Gegenteil ist es – wie Judith Butler gezeigt hat – ein besonderes Merkmal der Sprache, dass sie Macht ausübt, dass sie Subjekten Plätze zuweist und sie ihnen raubt, dass sie ermutigen kann und verletzen, dass sie Möglichkeiten eröffnen und abschneiden kann.
Woher bezieht nun aber die Sprache diese Macht? Sind es nicht außersprachliche Konsequenzen, bei denen die Sprache Anleihe nimmt; z.B. die Schläge, die angedroht werden und nicht die Drohung, die durch Worte schlägt? Beruht nicht die Macht der Sprache überhaupt auf den Situationen, Institutionen und Handlungsketten, in die sie eingebunden ist?
Austins ausgeprägt illokutionäre Sprechakte wie ‚etwas schwören’ oder ‚jemanden verheiraten’ funktionieren ja gerade in der Weise, dass sie die sprachliche Form auf eine Formel reduzieren, deren Bedeutung durch ein dichtes Netz pragmatischer Konventionen bestimmt und gesichert ist. Die sprachliche Formel kann durch eine andere ersetzt werden, ohne dass sie ihre Wirkung einbüßt, solange der institutionelle Rahmen dafür sorgt, dass sie als funktional äquivalent gilt. Wie in den notationalen Systemen ist hier die Beschaffenheit des Materials bedeutungslos, das System ganz und gar von Konvention getragen.
Doch genauer betrachtet gilt dies nur in solchen hoch formalisierten Sonderfällen. Die illokutionäre Kraft von geläufigeren Sprechakten wie ‚jemanden einladen’ oder ‚sich entschuldigen’ speist sich auch aus einer ganz anderen Quelle. Wer solche Sprechhandlungen vollziehen möchte, muss sich zwar einerseits in den Konventionen bewegen, die bestimmen, was es heißt, jemanden einzuladen oder sich zu entschuldigen. Andererseits kann er dies nur, indem er gerade darauf achtet, welche Worte er wählt, wie er seine Sätze baut, in welchem Tonfall, in welchem Gestus und in welcher Situation er sie ausspricht. Die Erfüllung oder auch Variation des Sprechaktes ist hier nicht zu trennen von der Fülle des sprachlichen Materials und seinen Möglichkeiten. Jemanden einzuladen oder sich zu entschuldigen gelingt dann, wenn Wortwahl, Tonfall und Gestus abgestimmt und auf den Sprechakt eingerichtet werden. Das ist nicht immer leicht, denn nicht nur Worte und ihre Stellung im Satz, sondern auch die Nuancen von Tonfall und Sprechweise sind in Netzen assoziierter Formen und Verwendungen verwoben, die sie als Eigensinn in die Sprechsituation mit hineintragen. Durch eine winzige Verschiebung wird aus einer Feststellung eine Beleidigung und aus einer Frage ein Affront.
Die Materialität der Sprache zeigt sich also in all dem, was beachtet sein will, wenn ein Sprechakt gelingen soll und in dem, was offenbar missachtet wurde, wenn er scheitert. Und das, was sprachliches Handeln ausmacht, erweist sich in zweifacher Weise bestimmt: zum einen durch die intendierte Konvention, zum anderen durch den Eigensinn des sprachlichen Materials. Konstituiert wird dieses Spannungsverhältnis dadurch, dass ein und dieselbe Konvention durch sehr verschiedenes sprachliches Material erfüllt werden kann und umgekehrt die gleichen Worte, Satzstellungen und Gesten zur Erfüllung ganz verschiedener Konventionen dienen können. Genau aus diesem Spannungsverhältnis entsteht der sprachliche Raum als ein Raum, in dem sprachliche Prozesse offen, aber nicht beliebig, gerichtet, aber nicht determiniert sich vollziehen, und so gründet darin auch der Reichtum, die Plastizität und die Umfassendheit der Sprache.[1]
[1] Ausführlicher dazu: Kogge: 2002, 205-236.
Zitat
Mais cela même est la vertu du langage: c’est lui qui nous jette à ce qu’il signifie; il se dissimule à nos yeux par son opération même; son triomphe est de s’effacer et de nous donner accès, par delà les mots, à la pensée même de l’auteur, de telle sorte qu’après coup nous croyons nous être entretenus avec lui sans paroles, d’ esprit à esprit.
[…]
Sartre encore le dit très bien, que la lecture ‚prenne’ comme le feu prend. [1] J’approche l’allumette, j’enflamme un infime morceau de papier, et voilà que mon geste reçoit des choses un secours inspiré, [2] comme si la cheminée, le bois sec n’attendaient que lui pour déclencher le feu, [3] comme si l’allumette n’avait été qu’une de ces incantations magiques, un appel du semblable auquel le semblable répond hors de toute mesure. [4] Ainsi je me mets à lire paresseusement, je n’apporte qu’un peu de pensée – et soudain quelques mots m’évaillent, le feu prend, mes pensées flambent, il n’est plus rien dans le livre qui me laisse indifférent, le feu se nourrit de tout ce que la lecture y jette. Je reçois et je donne du même geste. [5] J’ai donné ma connaissance de la langue, j’ai apporté ce que je savais sur le sens de ces mots, de ces formes, de cette syntaxe. J’ai donné aussi toute une expérience des autres et des événements, toutes les interrogations qu’elle a laissées en moi, ces situations encore ouvertes, non liquidées et aussi celles dont je ne connais que trop l’ordinaire mode de résolution.
Mais le livre ne m’intéresserait pas tant s’il ne me parlait que de ce que je sais. De tout ce que j’apportais, il s’est servi pour m’attirer au-delà. A la faveur de ces signes dont l’auteur et moi sommes convenus, parce que nous parlons la même langue, il m’a fait croire justement que nous étions sur le terrain déjà commun des significations acquises et disponibles. Il s’est installé dans mon monde. [6] Puis, insensiblement, il a détourné les signes de leur sens ordinaire, et ils m’entraînent comme un tourbillon vers cet autre sens que je vais rejoindre.
[…]
Le langage parlé, c’est celui que le lecteur apportait avec lui, c’est la masse des rapports de signes etablis à significations disponibles … Mais le langage parlant, c’est l’interpellation que le livre adresse au lecteur non prévenu, c’est cette opération par laquelle un certain arrangement des signes et des significations déjà disponibles en vient à altérer, puis à transfigurer chacun d’eux et finalement à sécréter une signification neuve …
[1] „Aber gerade darin liegt die Stärke der Sprache: sie ist es, die uns zu dem hinführt, was sie bedeutet; sie verbirgt sich vor unseren Augen durch ihre eigene Tätigkeit; ihr Triumph ist es, sich selbst auszulöschen und uns über die Worte hinaus Zugang zu den Gedanken des Autors selbst zu verschaffen, so dass wir nachträglich glauben, wir hätten uns ohne Worte mit ihm unterhalten, von Geist zu Geist. […] und Sartre noch sagt treffend, dass man durch die Lektüre ‚gefangen‘ werden kann wie etwas Feuer fängt. [1] Ich nähere das Streichholz, ich entzünde ein winziges Stück Papier, und dann erhält meine Geste von den Dingen anfeuernde Unterstützung, [2] als ob der Kamin und das trockene Holz nur darauf warteten, um das Feuer endlich zu entfesseln, [3] als ob das Streichholz nur eine jener magischen Beschwörungen gewesen wäre, ein Appell des Gleichen, auf welchen das Gleiche maßlos anspricht. [4] Genauso beginne ich träge zu lesen, trage nur wenige Gedanken bei – und plötzlich wecken mich einige Worte auf, das Feuer greift um sich, meine Gedanken entflammen, nichts im Buch lässt mich mehr gleichgültig, das Feuer speist sich aus allem, was die Lektüre hineinwirft. Mit ein und derselben Gebärde nehme ich und gebe. [5] Ich habe meine Sprachkenntnisse beigesteuert; alles, was ich vom Sinn dieser Worte, dieser Formen, dieser Syntax schon wusste, habe ich miteingebracht. Ebenfalls beigesteuert habe ich meine ganze Erfahrung von anderen und von Ereignissen, alle Fragen, die sie in mir zurückgelassen haben, jene noch offenen, unerledigten Situationen und auch solche, deren gewöhnliche Lösungswege ich nur zu gut kenne. Aber das Buch würde mich nicht so sehr interessieren, spräche es nur über das, was ich schon kenne. Es hat sich all dessen bedient, was ich beigesteuert habe, um mich darüber hinaus zu locken. Mit Hilfe dieser Zeichen, über die der Autor und ich uns einig sind, weil wir dieselbe Sprache sprechen, hat er mich glauben lassen, wir befänden uns schon auf dem gemeinsamen Boden erworbener und verfügbarer Bedeutungen. Er hat sich eingenistet in meiner Welt. [6] Dann hat er auf unmerkliche Weise die Zeichen von ihrem gebräuchlichen Sinn abgebracht, und nun ziehen sie mich wie ein Wirbel in diesen anderen Sinn hinein, den ich antreffen werde. […] Die gesprochene Sprache, das ist jene, die der Leser mitbrachte, es ist die Menge der Bezüge zwischen den etablierten Zeichen und verfügbaren Bedeutungen […] Die sprechende Sprache aber ist jene Aufforderung, die das Buch an den unvorbereiteten Leser richtet; es ist jener Vorgang, durch den sich eine gewisse Anordnung von Zeichen und schon verfügbaren Bedeutungen verändert und umformt, bis ein jedes schließlich eine neue Bedeutung aussondert …“ (Merleau-Ponty: 1993, 34ff.)