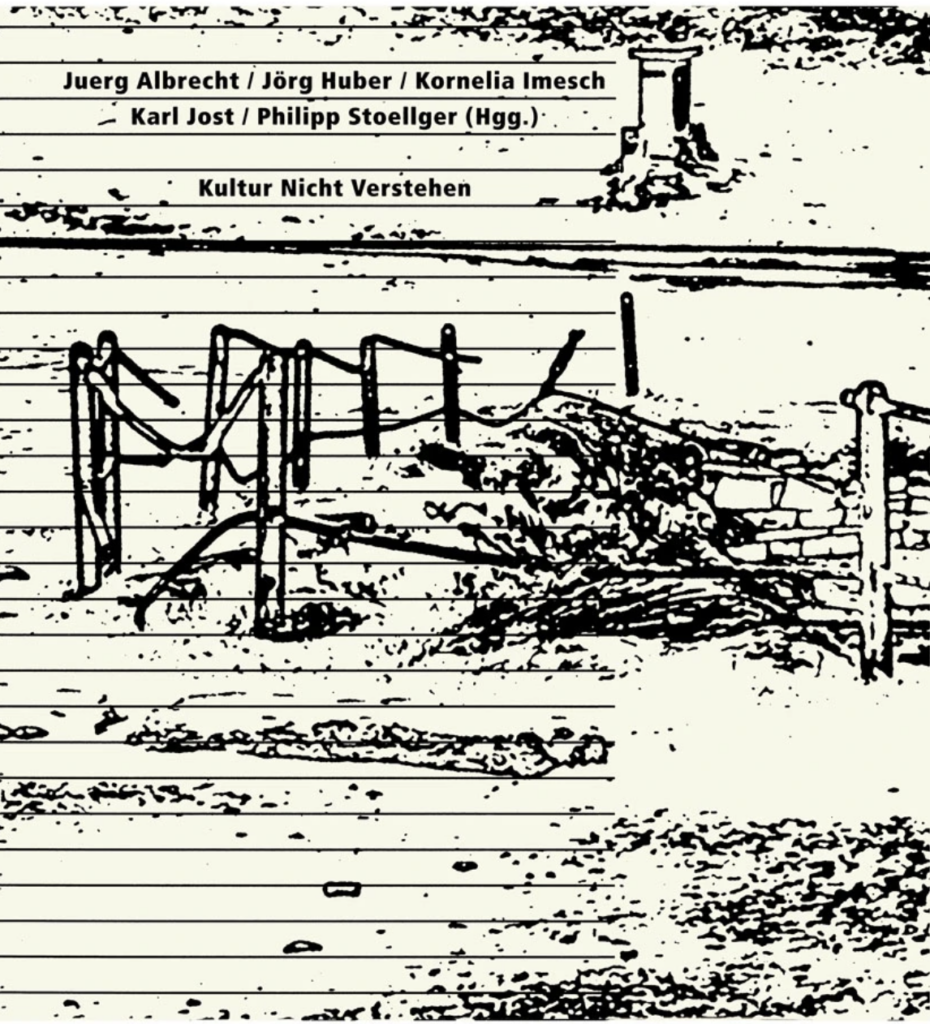Die Kunst des Nichtverstehens
In: Juerg Albrecht/ Jörg Huber/ Kornelia Imesch/ Karl Jost/ Philipp Stoellger (Hg.): Kultur Nicht Verstehen. Produktives Nichtverstehen und Verstehen als Gestaltung, Edition Voldemeer, Springer, Zürich, Wien, New York 2005, S. 119-144.
Einleitung
Es gehört zum Phänomen des Nichtverstehens, daß die entscheidenden Momente seines Sich-Ereignens kaum vorhersehbar, für den Betroffenen überraschend sind. Dennoch ist dieses Phänomen nicht bloß privativ, Entzug von Orientierung, Ordnung, Struktur. Es ist nicht die Negation des Verstehens, sondern, wie dieses, ein Prozeß, der in seinen Momenten und Effekten zu beschreiben ist. Dies soll im Folgenden geschehen.
Dazu werde ich zunächst herausarbeiten, wie der Verstehensbegriff der philosophischen Hermeneutik einen Ansatzpunkt bietet, hinter das Verstehen zu gelangen, das Nichtverstehen zum Thema zu machen. Im zweiten Abschnitt wird dann das Nichtverstehen in seinen verschiedenen Erscheinungsformen, Erfahrungen und Strukturen analysiert, um dann, im dritten Abschnitt, Überlegungen darüber anzustellen, was eine Kunst des Nichtverstehens heißen könnte.
„Soll das Nichtverstehen ausgehalten werden, so bedarf es der kleinschrittigen, wirklichen Vertiefung der Frage, wie anders die eigene Welt sein müsste, um das zu verstehen, was als Phänomen gegeben ist. In der Behutsamkeit dieser Bewegung kann zweierlei immer schärfere Konturen gewinnen: die unaufhebbare Eigenständigkeit des gegebenen Phänomens gegenüber allen Mustern des Vorverständnisses und die Strukturen dieses Vorverständnisses selbst, die unser gewöhnliches Tun und Lassen zugleich ermöglichen und begrenzen. In dieser Bewegung hebt sich das Nichtverstehen nicht auf, sondern spitzt sich zu auf den Punkt, an dem wir in unserem (Nicht-)Verstehen Grenzen finden, die wir dabei in manchen Fällen bereits überschritten haben, an dem wir in anderen aber gerade das finden, worüber wir nicht hinaus können und nicht hinaus wollen.“
Leseprobe
- Erscheinungsweisen des Nichtverstehens: Unkenntnis, Unsinn, Widersinn
Nichtverstehen kann eine ganz harmlose oder aber auch eine extrem problematische Angelegenheit sein. Beginnt man, Beispiele zu sammeln, so öffnet sich bald eine unendlich scheinende Mannigfaltigkeit von Phänomenen. Um aber zunächst einmal den beiden verbreiteten, eingangs genannten Vorurteilen, Nichtverstehen sei entweder durch gegebene Differenzen gleichsam natürlich bedingt oder aber nur eine Folge situativen Unvermögens, entgegenzutreten, sollen im folgenden drei Typen des Nichtverstehens unterschieden werden: Nichtverstehen im Modus der Unkenntnis, Nichtverstehen im Modus des Unsinns und Nichtverstehen im Modus des Widersinns.[1]
Nichtverstehen im Modus der Unkenntnis ist der harmlose Fall des Nichtverstehens, der Fall, den eine aufgeklärte, universalistische Sicht auf den Menschen und die menschlichen Vermögen voraussetzt und als einzigen annimmt. In dieser Erscheinungsweise des Nichtverstehens liegt der Grund des ausgesetzten Verstehens in einer Unkenntnis, die durch eine schlichte Information schlichtweg behoben werden kann. Ich kenne beispielsweise zwar ein bestimmtes Kartenspiel, weiß aber, da ich es noch nie mit Joker gespielt habe, nicht, wie diese bestimmte Karte eingesetzt wird. Ein Hinweis genügt, und ich habe verstanden. Oder: Ich kenne zwar Werkzeuge, auch Meterstäbe, weiß aber nicht, wie ein Messschieber zur Ermittlung des Durchmessers einer Bohrung benutzt wird. Ich lasse es mir vormachen, und so zeigt es sich mir ›unmittelbar‹. Oder: Ein Freund sagt Dinge, die mich verletzen und da ich davon ausgehe, daß der Freund um die betreffenden Umstände weiß, verstehe ich sein Verhalten nicht. Doch sobald ich erfahre, daß ihm dieser Hintergrund doch nicht bewusst war, hebt sich mein Nichtverstehen auf. Nichtverstehen im Modus des Unwissens hat lediglich mit den Strukturen des aktuell verfügbaren Wissens zu tun. Eine Information, ein Hinweis, eine kurze Erklärung genügen, um die Wissenslücke zu schließen und den vertrauten Grund unproblematischer Handlungsmuster wieder herzustellen.
Gäbe es nur diese Form des Nichtverstehens, dann müsste die Realität eine eindimensionale und homogene Ordnung sein, bar aller qualitativen Differenzen. Die Realität wäre in etwa eine, wie Carnap sie sich vorstellt: eine Ordnung, die aus distinkten Zuständen und Relationen zwischen diesen Zuständen aufgebaut ist. In dieser Welt bedeutet, etwas zu verstehen, ein Wissen um Zustände und Relationen zu erlangen; Verstehensbildung heißt, Informationen zu akkumulieren.
Doch Carnaps Aufsatz zur Überwindung der Metaphysik widerlegt seine eigene These. Wenn er beispielsweise Heidegger vorwirft, das Wort ›nichts‹ irrtümlich als einen Gegenstandsnamen zu verwenden und deshalb metaphysische Scheinsätze zu bilden, dann dokumentiert sich darin eine Form des Nichtverstehens, die mit Unkenntnis wenig zu tun hat. Begriffsbildungen, die sich auf Phänomene in der Erfahrung beziehen und Nominalisierungen einsetzen, um die Selbständigkeit solcher Phänomene auszudrücken, können in dem rigoros logistisch-physikalistischen Weltbild, das Carnaps Überlegungen zugrunde liegt, nur als Chiffren für Gegenstände aufgefasst werden, die letztlich physikalisch beobachtbar sind. In einem Denksystem wie dem Carnaps sind Ausführungen über ein ›Nichts‹, das – wie bei Heidegger – beispielsweise in der Angst erfahren wird, schlicht Unsinn.[2]
Die Kategorie des Unsinns bezeichnet ein Nichtverstehen, das nicht lediglich auf einem Mangel an Information beruht, sondern das mit etwas konfrontiert ist, das sich – selbst wenn Bemühungen zu verstehen unternommen werden – nicht in die vertraute Ordnung des Vorverständnisses fügen läßt. Ein einfaches Beispiel kann den Unterschied der beiden Modi verdeutlichen. Wenn ich nicht verstehe, was eine T-förmige Markierung am Wanderweg bedeutet, genügt eine Nachfrage bei einem Ortskundigen, um darüber aufgeklärt zu werden, daß in dieser Gegend Wege, die enden oder gefährlich sind, so bezeichnet werden. Treffe ich dagegen auf einen Wegweiser, der die Richtung zum Wanderziel senkrecht nach oben anzeigt, so wird diese Einrichtung in keiner Weise mit der vertrauten Ordnung der Wegmarkierungen in Übereinstimmung zu bringen sein; ich werde diesen verirrten Zeiger entweder verärgert als Unsinn oder belustigt als Scherz auffassen.
Das Nichtverstehen im Modus des Unsinns ist nicht nur gemeinhin oder zufällig, sondern systematisch mit Kategorien wie ›Scherz‹ verknüpft. Was als Unsinn erfahren wird, kann als Scherz aufgefasst werden. Mit der Auffassung als Scherz verliert das ›Unsinnige‹ seinen Stachel. Das Nichtverstehen wird in gewisser Weise aufgehoben, geht über in ein Verstehen, aber in ein Verstehen besonderer Art. Denn das Gegebene wird hier nicht unmittelbar auf die vertraute Ordnung der Dinge bezogen; es wird vielmehr zunächst als Scherz und erst mittelbar als scherzhafter, vielleicht ironischer Kommentar zur Ordnung der Dinge verstanden. Möglich ist dies, weil und soweit in einer Kultur, in einem Vorverständnis, Sonderbereiche eingeräumt sind, die von den Kohärenz- und Seriösitätskriterien, die dort normalerweise gelten, befreit sind. Neben dem Scherzhaften gehören z.B. in einer rationalistischen und naturwissenschaftlich geprägten Weltauffassung zu diesen Sonderbereichen das Kindliche, das Religiöse, das Exotische und das Künstlerische. [3] Der Wegweiser könnte im Spiel kindlicher Phantasie seine ungewöhnliche Wendung bekommen haben, er könnte auch als Teil einer künstlerischen Inszenierung oder eines religiösen Rituals zu verstehen sein. So ist es auch kein Zufall, daß Carnap die in seinem Horizont unsinnig erscheinenden Sätze der Metaphysik in eine ganz bestimmte Genealogie rückt:
»Das Kind ist auf den ›bösen Tisch‹, der es gestoßen hat, zornig; der Primitive bemüht sich, den drohenden Dämon des Erdbebens zu versöhnen […] Das Erbe des Mythus tritt einerseits die Dichtung an […] andererseits die Theologie […]« Die »Metaphysik« ist ein »Ersatz für die Theologie auf der Stufe des systematischen, begrifflichen Denkens« und »ein Ersatz, allerdings ein unzulänglicher, für die Kunst«.[4]
Mit der Verweisung eines Zu-Verstehenden in solche Sonderbereiche ist häufig ein Gestus der Überheblichkeit verbunden. So weit allerdings solche Sonderbereiche als integraler Bestandteil der eigenen Kultur betrachtet werden, bleibt die Aufhebung des Nichtverstehens im Modus des Unsinns nicht gänzlich verständnislos. Der Umgang mit dem solchermaßen Aufgeräumten kann despektierlich, jovial, gleichgültig, aber auch liebevoll-passioniert sein. Von Verstehen im Sinne der Anstrengung und Leistung, die es bedeutet, die vertrauten Muster aufs Spiel zu setzen, um einem Gegebenen gerecht zu werden, kann keine Rede sein; aber auch nicht von einem Gegensatz grundsätzlicher Art, wie ihn Wittgenstein andeutet, wenn er schreibt: »Wo sich wirklich zwei Prinzipien treffen, die sich nicht miteinander aussöhnen können, da erklärt jeder den anderen für einen Narren und Ketzer.«[5] Solange ein Zu-Verstehendes im Rahmen einer Kategorie wie der des Spielerischen, Kindlichen, Künstlerischen verbucht werden kann, solange es aus dem Bereich der primär relevanten Denk- und Handlungsmuster ausgeschlossen bleibt, stellt es für diese Muster keine Gefahr dar, muß folglich auch nicht bekämpft werden.
Die Erfahrung des Nichtverstehens im Modus des Widersinns lässt sich wiederum am einfachsten mit Rekurs auf das Wegweiserbeispiel illustrieren. Wenn ich nach einem langen Wegstück hoffe, demnächst am Ziel anzulangen und dann an einer Weggabelung einen Wegweiser vorfinde, der das erstrebte Ziel genau in der Richtung anzeigt, aus der ich komme, dann erfahre ich eine Verkehrung meiner gesamten Orientierung, die mich als Widersinn angeht. Um komplexere Beispiele zu finden, lohnt sich allerdings ein Blick ins Revier der Ethnologie. Denn obwohl Unsinn und Widersinn Erfahrungsweisen sind, die gerade auch im Alltäglichen auftauchen, sind ihre Charakteristiken am deutlichsten an Fällen ausgesprochener Fremderfahrung zu ersehen.
Von den Tiwi, einem Stamm, der eine Inselgruppe nördlich von Australien bewohnt, berichtet Lévi-Strauss, daß sie eine sehr aufwendige Praxis der Namensgebung pflegen. Jedes Individuum trage mehrere Namen, die mehrmals in seinem Leben wechseln und die alle, mit samt allen Namen, die es je verliehen hat, bei seinem Tod unter Tabu fallen.[6] Den Sinn eines solchen Aufwandes und eines solchen verschwenderischen Reichtums an Namen zu verstehen, dürfte aus europäischer Perspektive einigermaßen schwer fallen. Denn Namen sind für uns zutiefst damit verbunden, Individuen zu identifizieren, so daß uns eine übersichtliche Ökonomie der Namensgebung unabdingbar scheint. Das Konzept ›Name‹ muß für die Tiwi etwas ganz anderes bedeuten, und Namen müssen eine Funktion haben, die sich tiefgreifend von der unserer Namen unterscheidet. Die Erklärungsversuche, die Lévi-Strauss anstellt, zeigen nun aber, daß das Nichtverstehen in diesem Fall – mit einigem Aufwand zwar, aber dennoch recht schlüssig – sich im Rekurs auf die volkstümlichen Gepflogenheiten, in denen wir Hunden, Pferden, Vögeln, Rindern und Blumen Eigennamen verleihen, verständlich machen lässt. Obwohl Lévi-Strauss nichts ferner liegt als eine Abwertung solcher Praktiken, so ist doch zu bemerken, daß der Bereich, aus dem die vertrauten Muster hier genommen sind, ein Bereich ist, der in unserer Kultur eher einen kindlich-spielerischen, denn einen ›seriösen‹, ›systematischen‹ und ›relevanten‹ Status innehat. So kann sich das Nichtverstehen angesichts eines verstörenden, unsinnig erscheinenden Phänomens beruhigen, indem es dieses mit einer vertrauten, aber marginalen Praxis der eigenen Kultur auf eine relativ harmlose Weise korreliert.
Genau diese Möglichkeit fehlt in einem anderen Beispiel, das Lévi-Strauss bei den Lugbara in Uganda findet. Die Namensgebung dieses Stammes wird in der Form praktiziert, daß die Kinder Namen erhalten, die in kränkender Weise auf schlechte Eigenschaften ihrer Eltern verweisen. So kann ein Kind beispielsweise »gibt nicht« heißen, was andeutet, daß »die Mutter ihren Ehemann schlecht ernährt«.[7] Diese Festschreibung von negativen Eigenschaften der Eltern in der Eltern-Kind-Beziehung führt zu einem Nichtverstehen ganz anderer Qualität, zu einem Nichtverstehen, das absolut, unhintergehbar scheint. Wir können uns vielleicht noch vorstellen, daß ein Kind nach Eigenschaften der Eltern benannt wird, obwohl im modernen Europa selbst dies vielerorts bedeutete, ein gewisses Neutralitätsgebot zu verletzen und die individuelle Eigenständigkeit des Kindes zu gering zu achten. Aber das Kind mit negativen Eigenschaften der Eltern zu benennen, scheint in jeder Hinsicht ›unmöglich‹ zu sein. ›Gerade das nicht!‹ möchte man sagen und drückte damit ein grundsätzliches, konsterniertes Nichtverstehen aus: das Nichtverstehen im Modus des Widersinns.
In der Erfahrung von Widersinn werden für gewöhnlich überhaupt keine Anstrengungen mehr unternommen zu verstehen. Vielmehr findet eine Bewegung der Abgrenzung statt, die solch ›Unverständliches‹ nicht mehr in einem Sonder- oder untergeordneten Bereich, sondern in einem Außen der eigenen Ordnung, ja: jeglicher denkbaren Ordnung der Dinge platziert und in entschiedener Ablehnung jede Nähe oder Verwandtschaft zu Verhältnissen dieser Art von sich weist.
Diese Entschiedenheit entspringt keiner Willkür. Sie hat ihr Fundament in grundsätzlichen Prägungen, die zentrale Bereiche unsere Kulturgeschichte bestimmen und in unser Vorverständnis eingegangen sind. Solche Grundbestimmungen kommen in ihrer Kontingenz zum Vorschein, wenn ein Ethnologe wie Lévi-Strauss nicht den normalen Weg der unmittelbaren Ablehnung geht, sondern versucht zu verstehen. Denn die Überlegungen, auf die Lévi-Strauss dabei geführt wird, sind implizite und explizite Topoi der Grenzüberschreitung. Eine Forschungshypothese, die Lévi-Strauss referiert, führt auf die Schwiegermutter als letztinstanzliche Namensgeberin und auf feindselige Affekte, die diese insbesondere gegenüber ihrer Schwiegertochter hegt. Lévi-Strauss verwirft diese Deutung aus systematischen Gründen. Interessanter ist es aber zu betrachten, aus welchem Feld dieser Topos, der Gemeinplatz der bösen Schwiegermutter, entnommen ist. Die böse Schwiegermutter ist uns als Figur unzähliger Witze und Schwänke so geläufig, daß der Begriff selbst zuweilen in erster Linie als Bezeichnung einer Witzfigur zu dienen scheint. Das semantische Feld der Lächerlichkeit fungiert nun aber nicht – wie die Sonderbereiche – zur Strukturierung einer inneren Komplexität, sondern zur Bezeichnung einer äußeren Grenze. Denn während das Kindliche, Spielerische, Künstlerische, Exotische oder Religiöse Bereiche sind, in denen sich auch der ›Ernsthafteste‹ zeitweise wieder findet oder zumindest hinwünscht, ist Lächerlichkeit ein ganz und gar zu Meidendes. Das Lächerlich-Machen hat Freud als eine besondere Form des Witzes analysiert – als den tendenziösen Witz, der eine zweite Person »zum Objekt der feindseligen oder sexuellen Aggression« macht, indem er eine dritte zum Bundesgenossen nimmt, »an der sich die Absicht des Witzes, Lust zu erzeugen, erfüllt.«[8] Im Gelingen solcher Rhetoriken dokumentiert und konstituiert sich zugleich eine Einigkeit über Ablehnung, eine Ausgrenzung, die bestimmt, was zugehörig und akzeptabel, was überhaupt der Mühe Wert scheint, bedacht und nachvollzogen zu werden – und was nicht. In einer Position der Ohnmacht halten sich die Menschen auf diese Weise für ihre unterdrückten Impulse schadlos; in einer Position der Macht resultieren die verschiedenen Formen der Diskriminierung.
Lévi-Strauss ist von beidem unendlich weit entfernt. Doch ein bezeichnend tiefes Unbehagen kommt auch bei ihm – gewissermaßen als Nachklang eines solchen Affektes in einem feinsinnigen und verständnisvollen Geist – zum Vorschein, wenn er die Deutung des Phänomens, der er zustimmt, mit einer Wendung kommentiert, die besonders überrascht, wenn man berücksichtigt, mit welcher Sympathie er ansonsten die Systeme des Wilden Denkens zur Darstellung bringt. Nach dieser Interpretation ist das Phänomen der negativen Namensgebung auf eine Umkehrung der Agens- und Patiensstrukturen zurückzuführen, nach der beispielsweise Verben wie ›verlieren‹ oder ›vergessen‹ so verwendet werden, »daß die vergessene Sache das Subjekt und der Vergessliche das Objekt bildet.«[9] Diese aus den Ergativsprachen bekannte Grundstruktur kommentiert Lévi-Strauss in auffallend kritischem Ton als »moralische Passivität, die ein von anderen geprägtes Selbstbildnis auf das Kind zurückwirft«[10] – mit einer Formulierung also, die in ihrem Subtext eine solche Fülle von konstitutiven Grundentscheidungen abendländischer Kulturentwicklung enthält, daß sie hier nur durch einige Stichpunkte angedeutet werden kann: das Gebot, sich als Akteur für Geschehnisse zu behaupten, Autonomie und Selbstbeherrschung zu demonstrieren; das Gebot, Verantwortung für seine Taten zu übernehmen, sie sich als Resultat eines freien Willens zuzurechnen; das Gebot, das eigene Tun einem universalen Maß des Richtigen oder Wahren zu unterstellen – nicht dem Urteil der Anderen; das Gebot, seine Privatsphäre gegen andere, auch gegen die Allgemeinheit, zu verteidigen.[11]
Als Zwischenergebnis lässt sich somit festhalten, daß mit der Unterscheidung von drei Modi des Nichtverstehens zum Vorschein kommt, wie die Sinnwelten, in denen wir denken, wahrnehmen und handeln, durch Muster strukturiert sind, die auf verschiedene Weise mit einem neu Gegebenen in Konflikt geraten können: Im Fall der Unkenntnis führt das Moment der Störung zu einer Bewegung der Ergänzung und erweiterten Orientierung. Im Fall des Unsinns führt die Erfahrung zu einer Grenzziehung innerhalb der vertrauten Ordnung des Sinns: das Gegebene wird als exotisch, spielerisch, künstlerisch oder naiv abgetan, damit in gewisser Weise doch verstanden, aber um den Preis, daß es aus dem Bereich der handlungsrelevanten Muster ausgeschlossen wird. Im Fall des Widersinns wird eine Grenzziehung vorgenommen, die das Gegebene kategorisch aus der Ordnung des Sinns ausschließt.
[1] Die folgenden Erörterungen gehen auf systematische Überlegungen zum Kultur-, Sinn, Verstehens- und Grenzbegriff zurück, die ausgeführt sind in: Werner Kogge, Die Grenzen des Verstehens: Kultur – Differenz – Diskretion, Weilerswist 2002.
[2] Dabei wird die entscheidende Frage, was dafür spricht, in der Philosophie von physikalischen Gegenständen und Sätzen und was dafür, von Phänomenen auszugehen, gar nicht gestellt.
[3] Vielleicht ist es nicht überflüssig klarzustellen, daß es sich bei dieser Aussage nicht um eine normative These handelt, auch nicht um meine eigene Auffassung des Stellenwerts verschiedener sozialer Subsysteme, sondern um eine Deskription einer Grundstruktur in der Ökonomie von Sinnsystemen, am Beispiel der dominanten Sinnordnung in westlichen-›aufgeklärten‹ Gesellschaften.
[4] Carnap (wie Anm. 5), S. 239f.
[5] Wittgenstein, Ludwig, Über Gewißheit, in: Ders., Bemerkungen über die Farben. Über Gewißheit. Zettel. Vermischte Bemerkungen,Werkausgabe Bd. 8, Frankfurt am Main 1999 (8. durchgesehene Aufl.), § 611.
[6] Claude Lévi-Strauss, Das wilde Denken, Frankfurt am Main 1968, S. 232ff; 243.
[7] Ebd. S. 209.
[8] Sigmund Freud (1905), Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten, Frankfurt am Main 1958, S. 80.
[9] Lévi-Strauss (wie Anm. 20), S. 210.
[10] Ebd. S. 209f.
[11] Um die Ubiquität solcher Selbstzuschreibungen in Abgrenzung von Anderem, hier insbesondere vom Orientalischen in den Diskursen, die ein okzidentales Selbstverständnis konstituieren, zu illustrieren, seien hier exemplarisch drei ganz heterogene Textstellen angeführt: »Denn da die Barbaren von Natur sklavischeren Sinns sind als die Griechen, und von ihnen wiederum die in Asien mehr als die in Europa wohnenden, so ertragen sie auch die despotische Herrschaft ohne Murren.« Aristoteles, Politeia, 1052a, 20ff. »Reden Sie nicht, wie es in der Luft liegt, junger Mensch, sondern wie es Ihrer europäischen Lebensform angemessen ist! Hier liegt vor allem viel Asien in der Luft […] richten Sie sich innerlich nicht nach Ihnen, lassen Sie sich von Ihren Begriffen nicht infizieren, setzen Sie vielmehr Ihr Wesen, Ihr höheres Wesen gegen das ihre, und halten Sie heilig, was Ihnen, dem Sohn des Westens, des göttlichen Westens, – dem Sohn der Zivilisation, nach Natur und Herkunft heilig ist, zum Beispiel die Zeit! […] Aber auch Ihr Verhalten zum Leiden sollte ein europäisches Verhalten sein, – nicht das des Ostens, der, weil er weich und zur Krankheit geneigt ist, diesen Ort so ausgiebig beschickt […]« Thomas Mann, Der Zauberberg, Berlin 1925, S. 409, 411. »C A F F E E, trink nicht so viel Kaffee. Nicht für Kinder ist der Türkentrank, schwächt die Nerven, macht dich blaß und krank. Sei doch kein Muselman, der das nicht lassen kann.« Kanon von Karl Gottlieb Hering (1765-1853), der sich auch in vielen Gesangsbüchern jüngerer Zeit findet.
Über Nichtverstehensstrukturen im Bildhaften – mit Bezug auf Überlegungen Wittgensteins

Wittgenstein bezieht sich auf Gesichtszeichnungen, die er zuvor mit der Bemerkung eingeführt hat: „Wäre ich ein guter Zeichner, könnte ich eine unzählbare Anzahl von Ausdrücken durch vier Striche erzeugen … Damit wären unsere Beschreibungen viel flexibler und unterschiedlicher als sie es durch den Ausdruck von Adjektiven sind.“[1]
Was lehrt diese Beobachtung Wittgensteins? Es gibt für uns offenbar Strukturen sehr verschiedener Art. In manchen macht die winzigste Veränderung für uns einen gewichtigen Unterschied, in anderen sind wir gar nicht in der Lage, selbst grobe Abweichungen zu bemerken. In Strukturgestalten wie Gesichtern bemerken wir die kleinsten Unterschiede nicht nur, weil Gesichter zu dem gehören, womit wir seit frühester Kindheit vertraut sind, sondern weil Veränderungen in Gesichtern für uns auch immer schon von Bedeutung waren. Es hängt meist viel, oft alles davon ab, was wir in einem Gesicht erkennen und deshalb lesen wir nirgendwo so sorgfältig und aufmerksam wie in Gesichtern.
Doch auch dieses ’Lesen’ kann unsicher sein oder scheitern. Es stellt sich nicht selten die Frage, was in einem bestimmten Gesichtsausdruck geschrieben steht. Für eine Antwort fehlt manchmal lediglich ein Hinweis auf den Zusammenhang, in dem beispielsweise, ein Lächeln, steht.[1]
Doch über solches Nichtverstehen aus Unkenntnis hinaus lassen sich mit Gesichtsbildern auch Erfahrungen des Un- und Widersinns machen.
[1] Wittgenstein bemerkt in diesem Zusammenhang: „Ein vollkommen starrer Gesichtsausdruck könnte kein freundlicher sein. Zum freundlichen Ausdruck gehört die Veränderlichkeit und die Unregelmäßigkeit. Die Unregelmäßigkeit gehört zur Physiognomie. Die Wichtigkeit für uns der feinen Abschattungen des Benehmens.“ (Wittgenstein, Bergen Electronic Edition, Item 232,657); Vgl. dazu: Werner Kogge: „‚Keine Fachprüfung in Menschenkenntnis‘: Wittgenstein über Person und Technik“, in: Personen – Ein interdisziplinärer Dialog, Beiträge des 25. Internationalen Wittgenstein-Symposiums, hrsg. von Christian Kanzian, Josef Quitterer und Edmund Runggaldier, Kirchberg am Wechsel (Austria) 2002, S. 118-120.
[1] Ebd. S. 14.
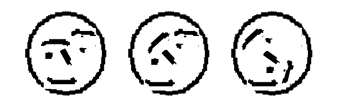
Verlieren die Teile ihre Relation zueinander, lassen sie sich nicht mehr als Elemente einer vertrauten Gestalt erkennen, so wird das Bemühen zu verstehen ins Leere laufen. Für das gewöhnliche ‚Lesen’ in Gesichtern fehlt die Voraussetzung, aus der Anordnung Sinn zu gewinnen. Sie erscheint als Unsinn. Nur wenn sich das Ensemble z.B. als Kunstwerk oder Teil eines Spiels betrachten läßt, sind wir vielleicht doch bereit, Verknüpfungen herzustellen und Gestalten zu sehen – mit der damit verbundenen Einschränkung allerdings.