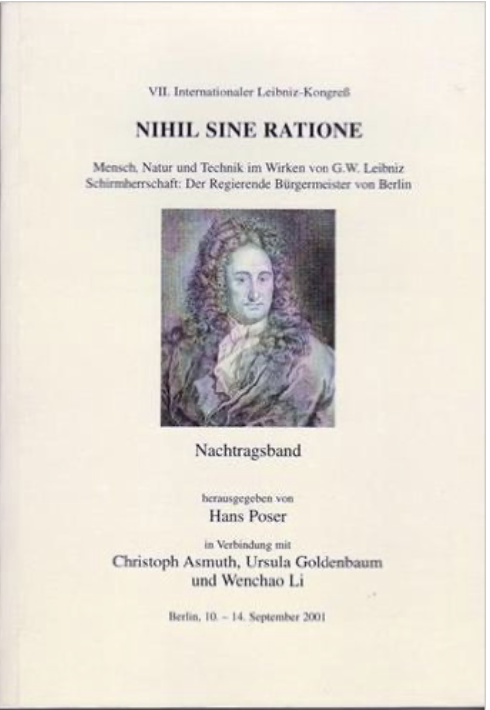Blinde Spiegel
Zur Konzeption der künstlichen Maschine bei Leibniz
In: Kongressband zum VII. Internationalen Leibniz-Kongress Nihil sine ratione: Mensch, Natur und Technik im Wir-ken von G. W. Leibniz, hrsg. v. Hans Poser, Berlin, September, S. 628-635.
Abstract
Die Konzeption der künstlichen Maschine bei Leibniz enthält ein interessantes Problem, das auch für die Technikphilosophie von Bedeutung ist. Wenn nämlich, wie Leibniz annimmt, ein vollkommener Geist ein vollkommenes Universum schafft, so gibt es darin keinen Teil, der nicht der vollkommenen Ordnung angemessen wäre. Befinden sich in einem solchen Universum aber verstandesbegabte Wesen, die beschränkt und zugleich schöpferisch sind, dann liegt der Schluß nahe, daß sie Gebilde realisieren, die selbst unvollkommen und beschränkt sind. Das Universum enthielte demnach neben Vollkommenem auch Unvollkommenes; künstliche Maschinen als Produkte begrenzter Vernunft würden zur Vorstellung eines harmonischen Universums im Widerspruch stehen. Hält man gegen die Vorstellung eines harmonischen Universums am Leibnizschen Konzept der künstlichen Maschine fest, so erscheint eine interessante Theorie technischer Perfektibilität: nämlich eine Theorie der relativen Perfektion in Abhängigkeit von der Perzeptivität für das umgebende Universum.
„Jeder organische Körper eines Lebewesens ist demnach eine Art göttlicher Maschine oder natürlichen Automats, der alle künstlichen Automaten unendlich weit übertrifft. Denn eine durch menschliche Kunst gebaute Maschine ist nicht Maschine in jedem ihrer Teile; so hat z.B. der Zahn eines Messingrades Teile oder Stückchen, die für uns nichts Kunstvolles mehr enthalten und denen man nichts von der Maschine anmerken kann, für die das Rad bestimmt war. Die Maschinen der Natur jedoch, d.h. die lebenden Körper, sind noch Maschinen in den kleinsten Teilen bis ins Unendliche. Das eben macht den Unterschied zwischen Natur und Kunst oder auch zwischen der göttlichen Kunst und der unsrigen aus.“
(Leibniz: Mon., S. 615)
Leseprobe
Werner Kogge (Berlin)
Blinde Spiegel: Zur Konzeption der künstlichen Maschine bei Leibniz
Im 17. Jahrhundert wurde das Konzept der Maschine zu einem Schlüsselbegriff philosophischer und wissenschaftlicher Diskurse. Die Maschinenmetapher war zwar zunächst nur auf die Ordnung des Kosmos angewandt worden, wurde dann aber immer öfter auch auf Lebewesen und Staat bezogen.
Hintergrund dieser Konjunktur war das Auftreten und die Verbreitung technischer Anlagen, insbesondere der mechanischen Räderuhr seit Ende des 13. Jahrhunderts. Bereits in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts finden sich erste Beispiele kosmologischer Beschreibungen in Begriffen der Uhrwerksmechanik. Aber erst Descartes Trennung der res extensa von der res cogitans machte eine schlüssige Auffassung des materiellen Universums als durchgängig mechanische Maschine möglich. Die Natur, die bei Aristoteles durch das Prinzip der Selbstbewegung gekennzeichnet war, wurde nun vollkommen mechanisch aufgefaßt und den Funktionsprinzipien der Maschine unterworfen, während zugleich der Mechanismus, der bei Aristoteles und seinen Nachfolgern noch das Prinzip naturwidriger Bewegung verkörperte – gänzlich physikalisch gedacht wurde.
Der künstlichen Maschine selbst wurde als bildspendende Semantik in dieser metaphorischen Übertragung wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die Philosophen des 17. Jahrhunderts dachten mit der Maschine den Kosmos, das Lebewesen und den Staat, sie waren wenig daran interessiert, was es mit dem technischen Artefakt selbst, seinem Auftreten und seiner Stellung im Verhältnis zu Natur und Mensch auf sich hatte. Dieser Fokus verhinderte aber nicht, daß Fragen solcher Art in ihren Werken implizit beantwortet oder als beantwortet vorausgesetzt wurden.
Schon der cartesische Gedanke eines durchgängig mechanischen Universums birgt die interessante Konstellation in sich, daß innerhalb eines Ordnungszusammenhangs, der keine anderen substantiellen Eigenschaften als die Ausdehnung und keine anderen Gesetzmäßigkeiten als mechanische aufweist, sich Gebilde befinden, die diese Gegebenheiten paradigmatisch verkörpern und damit in gewisser Weise verdoppeln. Wenn Descartes in den Prinzipien schreibt, daß ihn in der Naturerkenntnis „die durch Kunst gefertigten Werke nicht wenig unterstützt haben“, da es zwischen künstlichen und natürlichen Maschinen lediglich einen Größenunterschied der Bestandteile gebe, so wird die Maschine nicht nur zum Modell, sondern zu einem ‚Pars pro toto‘, das die Gesetzmäßigkeiten des Universums im Universum repräsentiert. Da es „in der Mechanik keine Gesetze gibt, die nicht auch in der Physik gälten“, lassen sich an der Maschine die Regeln der Natur ablesen. Mängel und Ungenauigkeiten einer künstlichen Maschine tun diesem epistemologischen Zusammenhang keinen Abbruch, weil der Unterschied zwischen den natürlichen, von Gott gefertigten Maschinen und den künstlichen aus Menschenhand lediglich graduell ist, insofern Gottes Maschinen „unvergleichlich besser konstruiert“ sind.
Während Descartes in seiner Unterscheidung der denkenden und der ausgedehnten Substanz Ordnungsbegriffe dem Denken zuschlägt und daher keine Schwierigkeiten hat, künstliche Maschinen trotz ihrer Unvollkommenheit als Teile und zugleich Modelle des materiellen Universums anzusehen, stellt sich für Leibniz, der von der Vorstellung einer vollkommenen Ordnung auch der materiellen Sphäre ausgeht, hier ein grundsätzliches Problem. Dieses Problem läßt sich folgendermaßen skizzieren:
Wenn ein vollkommener Geist ein vollkommenes Universum schafft, so gibt es darin keinen Teil, der nicht der vollkommenen Ordnung angemessen wäre. Befinden sich in einem solchen Universum aber verstandesbegabte Wesen, die (in einem bestimmten Sinne) beschränkt und zugleich schöpferisch sind, dann liegt der Schluß nahe, daß sie Gebilde realisieren und in die universalen Wirkungszusammenhänge einfügen, die selbst unvollkommen und beschränkt sind. Das Universum enthielte demnach neben Vollkommenem auch Unvollkommenes; künstliche Maschinen als Produkte begrenzter Vernunft würden zur Vorstellung eines harmonischen, perfekt geordneten Universums im Widerspruch stehen.
Ich möchte im Folgende zeigen, daß Leibniz alle in diesem Schluß angesprochenen Prämissen vertritt, aber nicht die Konklusion eines durch künstliche Maschinen seiner Vollkommenheit beraubten Universums. Zu diesem Schluß kommt er aber nur deshalb nicht – so meine These – da er den eigentlich herstellenden Aspekt der menschlichen Vernunft nicht berücksichtigt. Führt man diesen Gesichtspunkt gegen die Leibnizsche Vorstellung eines vollkommenen, harmonischen Universums aus, so erscheint allerdings bei Leibniz eine, bei Descartes noch nicht angelegte, sehr interessante Theorie der Perfektibilität künstlicher Maschinen: nämlich eine Theorie der relativen Perfektion in Abhängigkeit von der Perzeptivität für das umgebende Universum.
I
Die universale Anwendung der Maschinenmetapher brachte es mit sich, daß menschliche wie göttliche Schöpfungen als Maschinen bezeichnet wurden. Im Unterschied zu Descartes sieht Leibniz aber eine qualitative Differenz zwischen natürlichen und künstlichen Maschinen. Die „Modernen“ – so Leibniz über Descartes und seine Anhänger – haben „die Reform zu weit getrieben“. Indem sie „die Tiere zu bloßen Maschinen umgestalten und herabwürdigen“ verkennen sie den „unermeßlichen Abstand …, der zwischen den geringsten Erzeugnissen und Mechanismen der göttlichen Weisheit und den größten Kunstwerken eines begrenzten Geistes besteht: ein Unterschied, der nicht nur den Grad, sondern die Art selbst betrifft.“ Diese mangelhafte Einsicht ist weitreichend. Sie führt nicht nur zu einer falschen Auffassung über die Tierseele und den Organismus, sondern verstößt insgesamt „gegen die Ordnung der Dinge“.
Wir haben es also bei der Verkennung der Differenz zwischen künstlichen und natürlichen Maschinen mit einem kardinalen Problem zu tun. Doch worin besteht diese Differenz genau? Leibniz gibt eine scheinbar klare Antwort. Bei näherem Hinsehen erweist sie sich jedoch als schwieriger als zunächst angenommen. Er schreibt in der Monadologie:
„Jeder organische Körper eines Lebewesens ist demnach eine Art göttlicher Maschine oder natürlichen Automats, der alle künstlichen Automaten unendlich weit übertrifft. Denn eine durch menschliche Kunst gebaute Maschine ist nicht Maschine in jedem ihrer Teile; so hat z.B. der Zahn eines Messingrades Teile oder Stückchen, die für uns nichts Kunstvolles mehr enthalten und denen man nichts von der Maschine anmerken kann, für die das Rad bestimmt war. Die Maschinen der Natur jedoch, d.h. die lebenden Körper, sind noch Maschinen in den kleinsten Teilen bis ins Unendliche. Das eben macht den Unterschied zwischen Natur und Kunst oder auch zwischen der göttlichen Kunst und der unsrigen aus.“ (Mon., S. 615)
Die Differenz scheint klar bestimmt. Während natürliche Maschinen bis ins Unendliche wiederum aus Maschinen bestehen, gilt dies für künstliche Maschinen nicht. Sie sind aus trivialen Einzelteilen aufgebaut. Kann man also sagen, daß natürliche Maschinen eine innere Unendlichkeit aufweisen, die den künstlichen nicht zukommt? Das wäre eine klare Definition, die allerdings im Widerspruch zur Leibnizschen Vorstellung der Materie steht. Materie ist in jedem Fall, nicht nur in der Organisation des Lebewesens, „bis ins Unendliche teilbar, ja wirklich geteilt“. Die Unterscheidung kann also nicht auf die Dichotomie ‚endlich-unendlich‘ zurückgeführt werden, sondern muß zumindest auch im Begriff der Maschine begründet sein. Was aber ist eine Maschine?
Noch 1686/87, in seinem Briefwechsel mit Arnaud, hat Leibniz die Maschine mit einem Steinhaufen verglichen und als bloßes Sammelwesen bezeichnet. Diese Bestimmung steht allerdings im Widerspruch zu der Unterscheidung künstlicher von natürlichen Maschinen. Denn wäre die Maschine ein bloßes Aggregat, dann würde es zwischen einem einfachen Aggregat und einem unendlich in solche Aggregate aufgeteilten Gebilde keinen Unterschied geben. Es handelte sich in jedem Fall um nichts anderes als eine Materieansammlung, der jegliche Einheit nur als äußere Vorstellung auferlegt sein könnte. Eine Maschine muß also, gemäß der Unterscheidung künstlicher und natürlicher Maschinen, die Leibniz seit seiner Schrift Système nouveau von 1695 immer wieder in der oben zitierten Form ausgeführt hat, bereits als ein je spezifischer Ordnungszustand von Materie aufgefaßt werden.
Das heißt nicht, daß Maschinen anderen Gesetzen als den mechanischen unterworfen sind. Leibniz betont immer wieder, zuletzt noch 1715/16 in seinen Streitschriften mit Clarke, daß die Vorgänge in einer natürlichen Maschine „ebenso mechanisch wie die in einer Uhr“ ablaufen. Jedoch sind in einer Maschine die mechanischen Gesetzmäßigkeiten jeweils in einer bestimmten Form realisiert. Es bedarf daher keines außer-mechanischen Lebensprinzips, um die natürliche von der künstlichen Maschine zu unterscheiden. Vielmehr hebt sich die natürliche Maschine dadurch von der künstlichen ab, daß sie eine bis ins Unendliche gehende Durchgestaltung einer bestimmten Realisation mechanisch möglicher Ordnung darstellt.
Umgekehrt heißt das für die künstliche Maschine, daß deren Materie nur mit beschränkter Eingriffstiefe ihrer inneren Ordnung unterworfen ist. Im Vergleich zu natürlichen Maschinen sind künstliche Maschinen in diesem Sinne als defizient anzusehen.
II
Die Defizienz künstlicher gegenüber natürlichen Maschinen wäre kein so grundsätzlich bedeutsames Thema, wenn nicht die gesamte „Ordnung der Dinge“ davon betroffen wäre. Inwiefern dies aber der Fall ist, läßt sich an der Stellung ersehen, die natürliche Maschinen in dieser Ordnung einnehmen.
Die Seelen oder Monaden werden ja bekanntlich von Leibniz als einfache, immaterielle Substanzen beschrieben. Es sind zwei Reiche, das eine vollständig ausgefüllt mit Materie, die mechanischen Wirkursachen unterworfen ist, das andere ebenso erfüllt mit Seelischem. Verbunden sind die beiden zum einen durch das System der prästabilierten Harmonie, durch das die seelischen und materiellen Prozesse immer schon aufeinander eingestimmt sind; zum anderen dadurch, daß organische Körper stets beseelt und Seelen stets mit einem Körper verknüpft sind. Die harmonische Koordinierung dieser beiden ansonsten je eigengesetzlichen Wesenheiten bringt es mit sich, daß die Monade eine ebenso vollkommene Ordnung darstellt wie der beseelte Körper.
Obwohl die körperliche Welt anderen Gesetzen gehorcht als die seelische, sind die beiden Wesen in der Form ihrer Ordnung symmetrisch aufeinander bezogen. Die Monade wird durch ihre Verknüpfung mit dem Körper, der Teil einer von Materie durchgängig erfüllten Welt ist „ein lebender, der inneren Tätigkeit fähiger Spiegel, der das Universum … darstellt und der ebenso geregelt ist, wie dieses selbst“ (PNG, S. 593); zugleich bedeutet für den Körper die Verbundenheit mit der Monade, die keine anderen Eigenschaften als ihre Perzeptionen hat, daß in ihm eine „durchgehende Ordnung herrschen“ (Mon., S. 615) muß. Der reinen und vollkommenen Spiegelhaftigkeit der Monade entspricht die bis ins Unendliche reichende Organisiertheit des lebendigen Körpers. Dessen natürliche Maschine kann nur deshalb mit der vollkommenen Perzeption des unendlichen Universums durch die Monade übereinstimmen, weil er in sich eine bis ins Unendliche reichende Ordnung verkörpert.
Wenden wir nach diesen Ausführungen den Blick wiederum zur künstlichen Maschine, so läßt sich nun deren spezifisches Defizit näher qualifizieren: Während Leibniz in seiner Unterscheidung künstlicher und natürlicher Maschinen für erstere nur die Beschränktheit einer bloß endlichen Geordnetheit benennt, zeigt sich nun, daß dieser ontologische zugleich ein epistemologischer Mangel ist. Anders als der natürliche Körper, der eine vollkommene Repräsentation des Universums darstellt, kann die künstliche Maschine das Universum nur so weit spiegeln, als auch sie in sich geordnet ist. Als endlich gestaltete ist die künstliche Maschine nur begrenzt als Spiegel des Universums tauglich; sie ist sozusagen ein blinder Spiegel.
Anders als bei Descartes und Bacon, für die die Natur „an Konstruktionsregeln des Menschen“ gebunden ist, kann an der künstlichen Maschine bei Leibniz die Ordnung der Natur nur in eingeschränkter Weise abgelesen werden.
III.
Aus der Unterscheidung von künstlichen und natürlichen Maschinen folgt also, daß künstliche Maschinen insofern unvollkommen sind, als sie nicht in der Lage sind, die Ordnung des Universums vollkommen in sich zu realisieren. Damit unterscheiden sie sich aber nicht nur von den natürlichen Maschinen, sondern allgemeiner von allen nicht artifiziell entstandenen materiellen Gebilden. Denn in einem unendlich erfüllten Kosmos hat jeder Teil, relativ zu seiner Entfernung, Wirkungen auf jeden anderen. Das heißt, daß jede materielle Konfiguration im Universum unmittelbar aus dem Zusammenspiel unendlich vieler Ursachen hervorgeht; das Universum ist ein kontinuierlicher Ursache-Wirkungszusammenhang. Es gibt also im Bereich der Materie nach Leibniz ebensowenig wie nach Descartes Brüche oder Beschränkungen der mechanischen Wirkungszusammenhänge.
Die künstliche Maschine ist aber – wie oben gezeigt – kein bloßes Aggregat, da sie zu einem gewissen Grade – wenngleich nicht durch sich selbst, wie der organische Körper – in sich nach einem inneren Prinzip geordnet ist. Diese innere Regulierung kann nicht aus den natürlichen Wirkungszusammenhängen begründet werden, da diese nur die je sich ergebenden, niemals funktional in sich selbst begründete Ordnungszusammenhänge hervorbringen. Die funktionale Ordnung der künstlichen Maschine muß also in der Sphäre des Seelischen und Geistigen gründen.
Leibniz deutet den Entstehungszusammenhang künstlicher Maschinen lediglich darin an, daß er sie – wie oben zitiert – als „Kunstwerke() eines begrenzten Geistes“ bezeichnet. Folgen wir diesem Hinweis zu seiner Theorie der beschränkten Erkenntnis, dann finden wir genau das Glied, das in der Argumentationskette benötigt wird, um verständlich zu machen, warum künstliche Maschinen defizient sind.
Zwar ist die Monade, wie Leibniz schreibt, in ihrer Perzeption des Universums nicht auf einen Ausschnitt beschränkt. Jedoch ist ihre „Vorstellung, was die Besonderheiten des Universums anlangt, nur verworren und nur bei einem geringen Teil der Dinge, nämlich bei solchen, die für die Monade die nächsten oder größten sind, distinkt … denn sonst wäre jede Monade eine Gottheit.“ (Mon., S. 614) So hat die Monade zwar alle unendlichen Distinktionen des Universums mitsamt dessen vergangenen und zukünftigen Zuständen, wie Leibniz metaphorisch sagt, als Falten in sich, sie ist jedoch „nicht imstande, mit einem Schlage alle ihre Falten zur Entwicklung zu bringen, denn diese gehen ins Unendliche.“ (Mon., S. 615)
Zwischen der Seele, die Leibniz auch Tieren zuschreibt, und der Vernunft, die dem Menschen vorbehalten ist, gibt es zwar den entscheidenden Unterschied, daß vernünftige Wesen zur Reflexion in der Lage sind, zu einer Vorstellung des Ichs und zur Einsicht in die Prinzipien, nach denen Gott die Ordnung des Universums geschaffen hat. (PNG, S. 595, 600) Jedoch bleibt auch die Vernunft beschränkt. Sie kann zwar, wie Aron Gurwitsch ausführt, im allgemeinen ein deutliches „Wissen um“ die Unendlichkeit der Welt gewinnen, jedoch kein „Kennen“ der darin enthaltenen Einzelheiten. „Die Begrenztheit des menschlichen Geistes kommt zum Ausdruck und wurzelt in der Beschränktheit des menschlichen Wissens auf das Allgemeine und Abstrakte.“ Auch in Philosophie und Mathematik können vernunftbegabte Wesen angemessene Erkenntnis nur unvollständig, auf Grund allgemeiner Begriffe und Regeln, aber nicht als vollständige Bestimmung der unendlichen Einzelheiten erlangen. Dabei ist der Geist, wie Leibniz andeutet, sofern er „die Wissenschaften entdeckt, gemäß denen Gott alle Dinge angeordnet hat, indem er sie nach Maß, Zahl und Gewicht erschuf“, nicht nur „ein Spiegel des Universums der Geschöpfe“, sondern auch „architektonisch.“ (PNG, S. 600)
Allerdings ist diese Nachahmung von Gottes Schöpfung durch die Seele „in ihrer kleinen Welt, in der sie sich betätigen darf“ (PNG, S. 600) verhältnismäßig folgenlos, solange sie im Bereich des Geistigen bleibt, in dem es nach Leibniz keine Ursache-Wirkungsverhältnisse gibt. Wird der Geist nun aber in dem Sinne architektonisch, daß er künstliche Systeme und Maschinen schafft, die materialiter realisiert werden, dann taucht eine Problemdimension auf, die bei Leibniz ganz undenkbar scheint: das Problem eines materiell Unvollkommenen.
IV
Leibniz hat keinen Begriff eines transitiven Handelns. Zwar ist dynamische Aktivität eines der Kennzeichen der Monaden, jedoch ist diese Aktivität rein immanent. „Die Tätigkeit der Monade hält sich völlig innerhalb dieser selbst; die Monade ist tätig, indem sie gemäß dem ihr eigenen individuellen Gesetz, das eine Variante eines universalen Gesetzes bildet, sich fortschreitend in ihre Bestimmungen und Accidentien auseinanderlegt und sich in ihnen entfaltet.“ Durch die kategorische Trennung des Materiellen vom geistigen Reich der Substanzen schließt Leibniz jede unmittelbare Wirkung der geistigen Aktivität auf die materielle Sphäre aus. Es ist bemerkt worden, daß ein Begriff der Kraft, der in der Aktivität der Seele seinen Ursprung hat, die „Aufgabe des Prinzips der prästabilierten Harmonie zur Folge gehabt“ hätte. Dasselbe gilt für die Vorstellung einer Aktivität, die sich in der materiellen Welt verwirklicht. Wird der architektonische Geist tatsächlich zum Baumeister, dann kreiert er Artefakte, die nicht allein im Wirkzusammenhang des Materiellen gegründet sind. Er überschreitet die Grenze, für die es doch nach Leibniz (der sich vornehmlich gegen die umgekehrte Grenzüberschreitung vom Materiellen zum Seelischen wendet) weder eine „Öffnung“ noch ein „Vehikel“ gibt.
Das Problem, das sich aus dieser Trennung ergibt, deutet sich bereits im ontologischen Status des Zeichens an. Wie Sybille Krämer nachweist, ist für den Leibnizschen Symbolbegriff die dinghafte Qualität des Zeichens von entscheidender Bedeutung. Durch die „Exteriorisierung geistiger Leistungen“ in „fixierbaren, handgreiflich manipulierbaren Körper(n)“ wird die regelhafte, von der Interpretation unabhängige Kombinatorik des Kalküls erst möglich. Allerdings stehen solche Zeichenkonstrukte nicht in einer Abbildbeziehung zur Welt.
„Alles, was wirklich existiert, ist individuell, die Gegenstände aber, die als Referenzgegenstände kalkülisierter Zeichenausdrücke eingeführt werden, verfügen über eine ausschließlich formale Identität, sind also ideale und abstrakte Konstrukte des Geistes. Daher können wir uns mit kalkülisierten Erkenntnisverfahren nicht mehr auf das, was wirklich existiert, also auf die wirklichen Begebenheiten in der Welt beziehen, sondern nur noch auf die Modelle von der Welt, d.h. aber: auf Zeichen.“
Die Konstruktion dinghafter Symbole zur Unterstützung von Geistesarbeit wirft zwar ebenfalls die Frage auf, wie die Zeichen als materielle Manifestationen immaterieller Prozesse entstehen können. Da sie jedoch als Hilfsmittel einer rein geistigen Tätigkeit auch nur in Modellen, also in einer geistig repräsentierten Welt wirksam werden, lassen sie sich als harmonisches Pendant zu bestimmten geistigen Aktivitäten im Reich des Materiellen ausweisen. Unzulänglichkeiten der Symbolsysteme wirken sich deshalb auch nur im Bereich der geistigen Aktivität, etwa im Prozeß der Selbstentfaltung der Monade aus.
Anders die künstlichen Maschinen; entwickelt man die Implikationen ihres Begriffs ohne von vornherein die vollkommene Harmonie des Universums zuzugestehen, dann ergibt sich folgendes Resultat: als materielle Komplexe, die auf mechanische Wirkung ausgelegt sind, ist die unvollkommene Ordnung der künstlichen Maschinen ein Wirkfaktor in der materiellen Welt. In ihrer konkreten Manifestation bringen sie die Beschränktheit der Vernunft im Reich der materiellen Wirkungszusammenhänge zum Vorschein. Dort tauchen sie auf als Konstrukte, die weder – wie die unorganisierte Materie – unmittelbar den Wirkungszusammenhängen unterworfen sind, noch – wie die natürliche Maschine – eine vollkommene Replikation des Universums darstellen. In ihrer Ordnung spiegelt sich die Ordnung der Welt, aber sie spiegelt sich nur in dem Maße, in dem die konstruierende Vernunft selbst distinkte Vorstellungen hat und umsetzen kann. Daher reproduziert die künstliche Maschine, wie die Monade, die Ordnung der Welt „in verworrener Weise“ (PNG, S. 599). Im Unterschied zu dieser aber manifestiert sich diese Konfusion in ihr konkret und materiell. Das bedeutet, daß die Ordnung des materiellen Universums, sofern sie künstliche Maschinen in sich birgt, auch Konfusionen und Diskontinuitäten aufweist.
V
Die soeben dargestellten Probleme fängt Leibniz durch zwei Theoreme auf. Zum einen faßt er mit seinem System der prästabilierten Harmonie auch das Wirkungsverhältnis zwischen Seele und Körper. „Denn soweit die Seele vollkommen ist und klare Gedanken hat, hat Gott den Körper der Seele angepaßt und es im voraus so eingerichtet, daß der Körper bestrebt ist, ihre Befehle auszuführen“ (Théod., S. 305). Das bedeutet, soweit sich dieser Gedanke auf das Verhältnis von Geist und künstlicher Maschine übertragen läßt, daß auch das Artefakt im voraus bereits relativ zur inneren Aktivität des Geistes eingerichtet ist; daß es also zu seiner Erzeugung keines transitiven Handelns bedarf. Zum anderen führt Leibniz mit seinem Gedanken vom „bestmöglichen Plan des Universums“ (Théod., S. 389) aus, daß die Unvollkommenheit der Vernunft im Gesamtplan Gottes durchaus vorgesehen sein kann. Das impliziert auch, daß das menschliche Wirken und dessen mangelhafte Werke als Übel zur Ordnung des Ganzen beitragen können. „Der Mensch ist … gleichsam ein kleiner Gott in seiner eigenen Welt oder seinem Mikrokosmos, den er nach seiner Weise regiert: er schafft zuweilen Wunderwerke darin, und oft ahmt seine Kunst die Natur nach. (…) Aber er begeht große Fehler, … weil Gott ihn seinen Sinnen überläßt … Gott verwendet aber mit großem Geschick alle Mängel dieser kleinen Welten zur größeren Zier seiner großen Welt. (…) (So) vereinen sich die scheinbaren Unschönheiten unserer kleinen Welten in der großen zu Schönheiten und enthalten nichts, was der Einheit eines allgemeinen, unendlich vollkommenen Prinzips entgegen wäre“.(Théod., S. 459ff)
Selbst wenn wir Heutigen uns ein harmonisches Universum eher als regulative Idee denn als gegebene Grundlage vorstellen können, gilt doch die Maxime, die Leibniz, von der Bestimmtheit des Verhängnisses unbeschadet, als verbindlich erachtet: nämlich, „daß wir alle künftige oder noch ungeschehene Dinge, so viel an Uns, und nach unserm besten Begriff, sollen gut und wohl zu machen suchen, und uns dadurch so viel immer müglich näher zu dem rechten Schaupunkte folgen.“
Wie dies im technischen Bereich geschehen kann, dazu liefert die Leibnizsche Unterscheidung künstlicher und natürlicher Maschinen einen Anhaltspunkt. Denn die natürliche Maschine zeichnet sich ja dadurch aus, daß sie einen vollkommenen Schaupunkt manifestiert, indem sie das sie umgebende Universum ins Unendliche in sich spiegelt. Eine natürliche Maschine wäre demnach der Vollkommenheit desto näher, je mehr sie die Mannigfaltigkeit des Universums in ihrem Innern reproduziert und dadurch in der Lage ist, die Bewegungen der äußeren Faktoren in ihrer Funktion zu ‚berücksichtigen‘.
Das Programm technischer Entwicklung war lange Zeit von der entgegengesetzten Idee ausgegangen. Wenn etwa Franz Reuleaux 1875 in seiner Schrift Theoretische Kinematik: Grundzüge des Maschinenwesens die Vervollkommnung der Technik als „die zunehmende kunstvolle Einschränkung der Bewegung bis zum völligen Ausschluß jeder Unbestimmtheit” beschreibt, dann zielt er auf die Isolierung und Funktionsspezifizierung des technischen Artefakts.
Wenn wir dagegen einige aktuelle Technologien genau betrachten, wie etwa den Herzschrittmacher der neuen Generation, der nicht mehr nach einem vorbestimmten Rhythmus, sondern in Bezug auf mannigfaltige organische Bedingungen arbeitet oder den Aufbau von visuell realisierten Internet-Chaträumen, die wesentlich besser sozialen Erfordernissen genügen als ihre rein schriftgestützten Vorgänger, dann zeigt sich, daß technische Entwicklung auch dahin führen kann, daß das Artefakt in seinem Funktionszusammenhang die spezifische Komplexität seiner Umgebung reproduziert.
Mit Leibnizschen Begriffen würde eine Verbesserung von Technik also bedeuten, nicht nur die allgemeinen und abstrakten Regeln der Ordnung – die, wie wir gesehen haben, ja stets gegenüber der faktischen Mannigfaltigkeit defizient bleiben – im technischen Artefakt zu realisieren, sondern dieses so zu gestalten, daß es die konkreten Bezüge, in denen es steht, in sich reproduzieren, distinkt repräsentieren und berücksichtigen kann. Denn, je besser technische Artefakte das konkrete Universum in sich zu spiegeln vermögen, desto weniger stehen sie im Widerspruch zu einer vollkommen harmonischen Ordnung.