Erschriebene Denkräume
Grammatologie in der Perspektive einer Philosophie der Praxis
In: Gernot Grube, Werner Kogge, Sybille Krämer (Hg.): Schrift. Kulturtechnik zwischen Auge, Hand und Maschine Fink Verlag, München 2005, S. 137-169.
Abstract
In diesem Text zeige ich, , dass die Eigentümlichkeit und der mediale Eigensinn von Schrift dann zum Vorschein kommen, wenn man sie als spezifische Praxis betrachtet. Das heißt auch, dass ich vorschlage, Derridas Grundintuition, Bedeutung als Effekt eines materialen Spiels zu denken, um die vielleicht kleine, aber entscheidende Wendung auf den Gedanken hin zu überschreiten, dass die Verwobenheit des Handelns in einem Material nie aufgeht, dass sie spannungsreich bleibt, dass sie einen Raum bildet, der ungesättigt ist und gerade dadurch produktiv werden kann. Es geht mir also darum, den Raum der Kulturtechnik als einen Spannungsraum zu beschreiben, in dem so grundsätzliche Erfahrungen wie das Ringen um Formulierungen, das überraschende Sehen von Zusammenhängen, das Umformen nach einer Ahnung, das Scheitern einer Komposition und viele mehr, die alles andere als maschinenhaft und logisch eindeutig verlaufen, ihren Ort haben.
Darstellungen aus dem Text
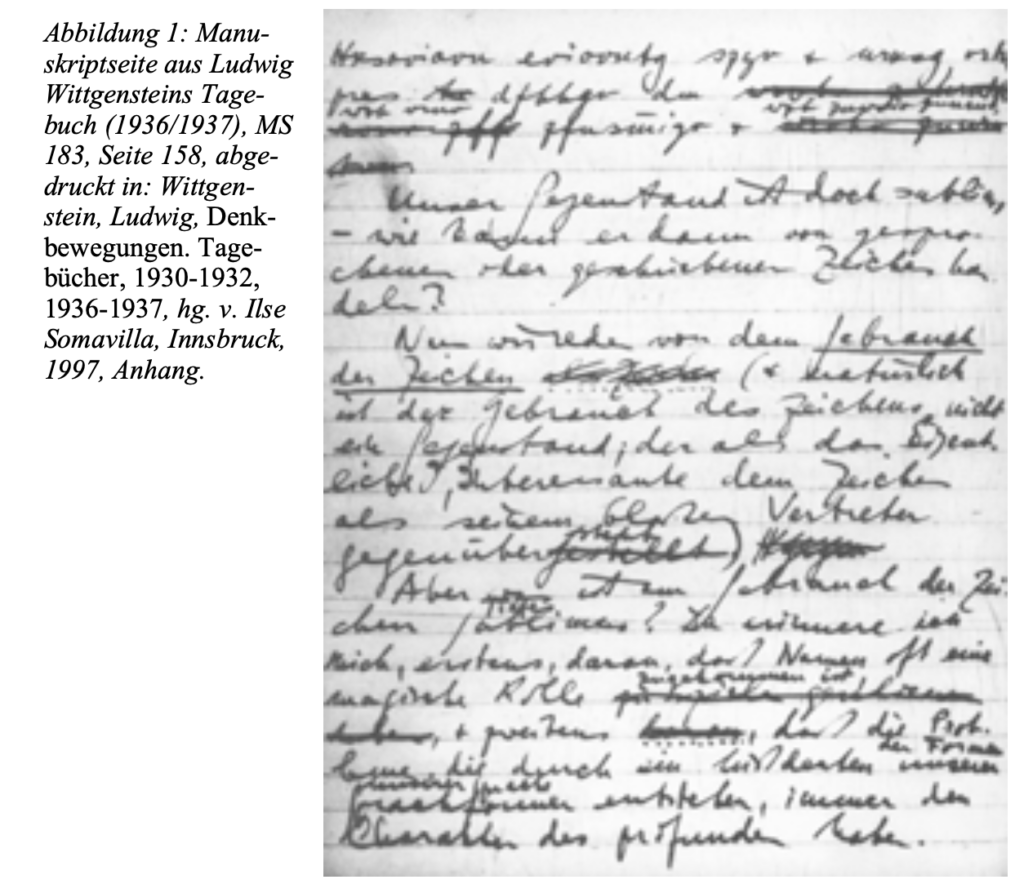
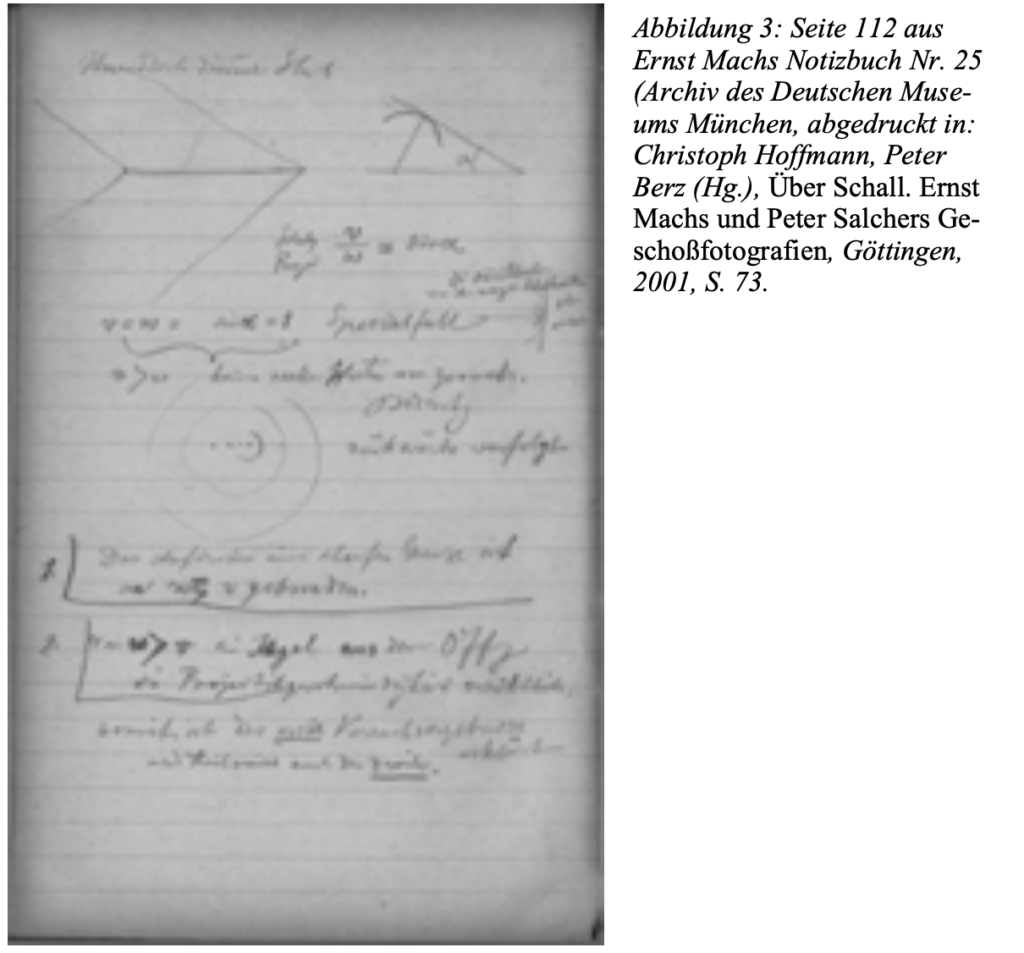

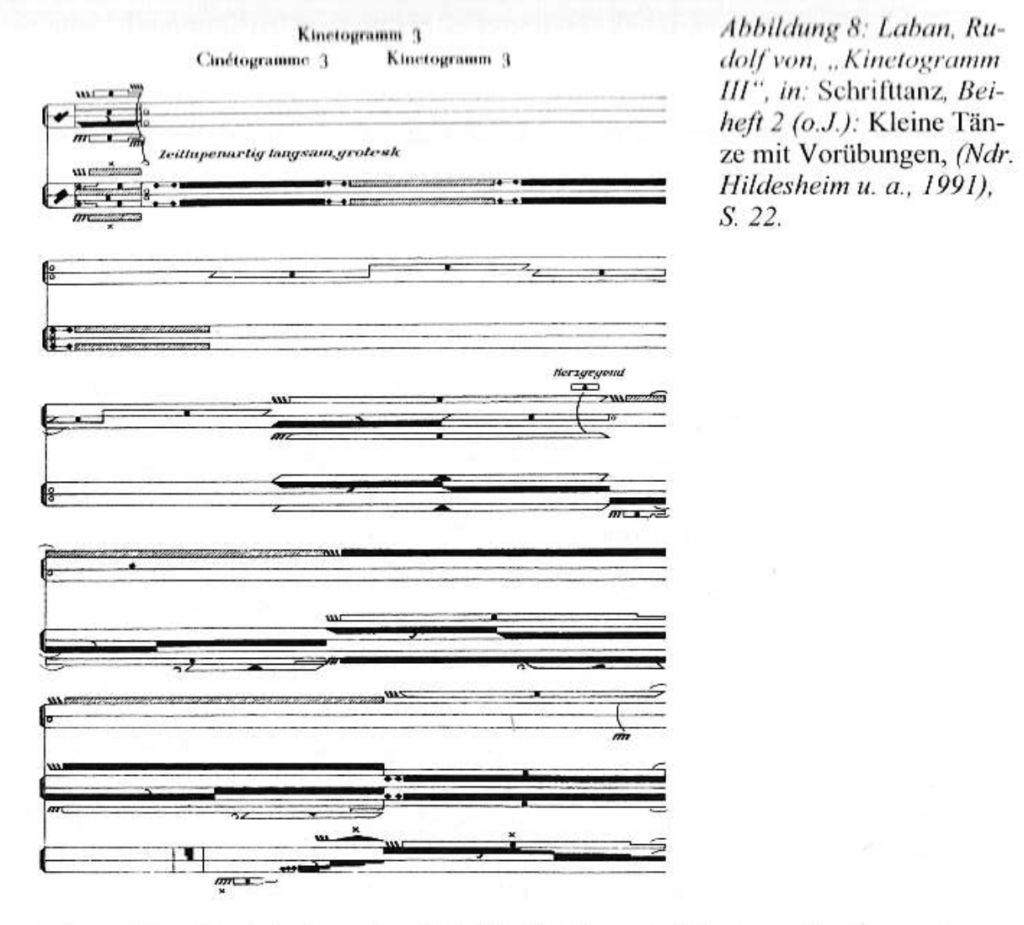
Leseprobe
In dem Augenblick, in dem Schrift zu einem eigenständigen philosophischen Thema wurde, war sie aus dieser Reflexion auch schon wieder verschwunden. Denn als Derrida, einen Gedanken Husserls aufgreifend, Mitte der 60er Jahre begann, Sprache, Philosophie und die abendländische Geschichte von der Schrift her zu denken, wurden zwar für einen Augenblick Strukturbegriffe wie Verräumlichung, Loslösung und Spur wirksam – kritisch merkt Derrida noch gegenüber Condillac an, dass Schrift gemäß einer Konzeption, die sie als eine bloße Übermittlungstechnik von Sprache auffasst „niemals auch nur im mindesten auf die Struktur und den Inhalt des Sinns (der Ideen) … einwirken“ könnte[1] –, doch treten dann für Derrida selbst solche Strukturbestimmungen von Schrift, die ihre eigenständige Materialität und Wirksamkeit betreffen, hinter einer zentralen These zurück: der These, dass das Zeichen nur durch die Differenz zu anderen Zeichen konstituiert werde und keinerlei unabhängige Substanz besitze. Dieses von Saussure entlehnte Postulat steht nun aber schon deshalb einer Thematisierung der Eigentümlichkeiten von Schrift entgegen, weil es für alle Symbolsysteme Gültigkeit beansprucht. Des weiteren lenkt Derridas Philosophie den Blick von der Schrift über die Schrift hinaus, da sie unter dem Titel der Schrift einen metaphysikkritischen Diskurs eröffnete, der Substanz und Präsenz durch den Rekurs auf Prozessualität und Differentialität zu unterlaufen suchte. Damit waren die Weichen bereits so gestellt, dass Schrift mit der Bewegung eines, sich selbst entziehenden, konstituierenden Spiels oder generativen Mechanismus gleichgesetzt wurde. Schrift wurde zu einer ‚Maschine‘, die in einer Bewegung von Wiederholung und Ersetzung Differenzen prozessiert. „Schreiben heißt, ein Zeichen (marque) produzieren, das eine Art ihrerseits nun produzierende Maschine konstituiert, die durch mein zukünftiges Verschwinden prinzipiell nicht daran gehindert wird, zu funktionieren und sich lesen und nachschreiben zu lassen.“[2] Mit diesem Ausgangspunkt lag es nur zu nahe, das Maschinenhafte der Schrift mit der Schriftförmigkeit bestimmter maschineller Prozesse zu identifizieren, eine Möglichkeit, die die Theoretiker der neuen Medien bald aufgriffen, um den Schreibakt der Maschine zu überantworten. So fordert etwa Vilém Flusser „das Schreiben, dieses Ordnen von Zeichen, Maschinen [zu] überlassen“[3] – die dies ohnehin besser leisteten als wir – und Friedrich Kittler meint: „Heute … läuft menschliches Schreiben durch Inschriften, die nicht nur mittels Elektonenlithographie in Silizium eingebrannt, sondern im Unterschied zu allen Schreibwerkzeugen der Geschichte auch imstande sind, selber zu lesen und zu schreiben.“ Daher sei „mit der Miniaturisierung aller Zeichen auf molekulare Maße […] der Schreibakt selbst verschwunden.“[4]
So zeichnen sich, seitdem Derrida Schrift in den Momenten Differentialität und Wiederholbarkeit kondensieren ließ, immer deutlicher Züge einer zuvor kaum geahnten Verwandtschaft zwischen Schrift und Maschine ab. Und natürlich geht es dabei nicht um irgendwelche Apparate, sondern um die digitalen, Differenzen prozessierenden Maschinen, die Bilder, Texte und Zahlenkolonnen in die gleichförmigen Abfolgen und Wiederholungen von Elektronenzuständen überführen. Doch während analoge Symbolformen wie Bild und Laut im Computer einer Digitalisierung unterworfen werden, erweist sich Schrift als digitales Notationssystem sui generis, so dass die Vorgeschichte des Computers als Papiermachine oder symbolische Maschine rekonstruiert werden kann.[5] Im Computer wäre demnach die Schrift gleichsam zu sich selbst gekommen. Das – wie Manfred Geier mit philosophischem Bedauern feststellt – „‚Spiel der Schrift‘, das im Phaidros(276e) als Kinderei der reifen Besonnenheit der erfüllten gesprochenen Rede gegenübergestellt wurde, hat sich kulturgeschichtlich vollendet. Es vollzieht sich kombinatorisch in den Grenzen der generativen Grammatiken, programmierbaren ‚scripts‘ und symbolischen Formalismen, die modellartig determinieren, was als Sprache gelten kann.“[6]
Diese kulturgeschichtliche Einschätzung wird theoretisch flankiert durch die Präzisierung, die der Begriff des Notationssystems in der Philosophie Nelson Goodmans erhalten hat.[7] Im Anschluss an diese Konzeption zeichnet sich in der jüngeren Schriftreflexion eine Tendenz ab, die Universalisierung der Schrift bei Derrida in der Weise zurückzunehmen, dass Graphismen nur wenn sie digital aufgebaut sind und sich nach rein syntaktischen Regeln transformieren lassen, als Schrift bestimmt werden. Mit Goodmans symboltheoretischer Definition von Notationssystemen rücken Schriften in die Klasse der symbolischen Ordnungen, in denen alle digitalen Systeme unabhängig von ihrer Erscheinungsweise versammelt sind. ‚Schrift‘ wird synonym mit der Kategorie der digitalen Operativität.[8]
Im Folgenden werde ich nun zeigen, dass diese Bewegung, bei der Schrift im Digital-Maschinenhaften aufgeht, Schrift zwar in einem ihrer Aspekte trifft, aber eben nur in einem ihrer Aspekte. Um Schrift umfassender zur Geltung zu bringen, plädiere ich dafür, sie als eigenständige Kulturtechnik möglichst genau zu beschreiben. Dabei gehe ich davon aus, dass die Eigentümlichkeit und der mediale Eigensinn von Schrift dann zum Vorschein kommen, wenn man sie als spezifische Praxis betrachtet. Das heißt auch, dass ich vorschlage, Derridas Grundintuition, Bedeutung als Effekt eines materialen Spiels zu denken, um die vielleicht kleine, aber entscheidende Wendung auf den Gedanken hin zu überschreiten, dass die Verwobenheit des Handelns in einem Material nie aufgeht, dass sie spannungsreich bleibt, dass sie einen ‚Raum‘ bildet, der ungesättigt ist und gerade dadurch produktiv werden kann. Es geht mir also darum, den Raum der Kulturtechnik als einen Spannungsraum zu beschreiben, in dem so grundsätzliche Erfahrungen wie das Ringen um Formulierungen, das überraschende Sehen von Zusammenhängen, das Umformen nach einer Ahnung, das Scheitern einer Komposition und viele mehr, die alles andere als maschinenhaft und logisch eindeutig verlaufen, ihren Ort haben.
- Die Ausblendung von Akt und Materialität bei Derrida
Es ist erstaunlich, dass in der Entwicklung und Folge einer Philosophie, die ihren Einsatz im Begriff der Schrift findet, Merkmale und Eigentümlichkeiten von Schrift als Medium oder Phänomen eine verschwindende Rolle spielen. Fast scheint es als wäre der begriffliche Zugang schließlich zufällig. Wenn, was für Schrift gilt, ebenso in der „gesprochenen Sprache und letztlich in der Totalität der ‚Erfahrung‘“[9] wieder zu finden ist, so lässt die Frage, welches Motiv den Einsatz des Schriftbegriffes leitet, vielleicht nur noch die Antwort zu: Am vertrauten Phänomen Schrift ist offensichtlicher, leichter aufweisbar, was dem Zeichenhaften überhaupt eigentümlich ist; Begriffe wie Wiederholbarkeit, Dekontextualisierbarkeit und differentielle Verwiesenheit sind keine Merkmale der Erscheinungsweisen von Schriftlichem, sondern bestimmen jeglichen Zeichenprozess.
Derridas Denkbewegung ist also nicht auf Schrift als ein Medium oder Phänomen hin gerichtet, sie benutzt phänomenale Aspekte von Schrift vielmehr, um eine differentielle Bewegung freizulegen, die jeder Erscheinung noch zugrunde liegt und sie konstituiert. ‚Urschrift‘, ‚Spur‘ und ‚différance‘ sind die Konzepte, die in wechselnder Besetzung ein Spiel von Differenzen, den Ort eines ‚immer schon‘ jeder Erscheinung, jedem Text, jeder Erfahrung Vorausliegenden bezeichnen. Genauer gesagt, bezeichnen und negieren solche Begriffe diesen Ort zugleich, denn keiner dieser Begriffe verweist auf ein irgend positiv Gegebenes. So gelingt es Derrida in einer Strategie von Ersetzung und Entzug, die Fundierungsbemühungen der Metaphysik zunächst in die Differentialität, Exteriorität, Wiederhol- und Ersetzbarkeit von Schriftlichem zu überführen, um sodann zu zeigen, dass diese Kategorien jeden Halt, jede Zentrierung, jede Stabilität unterlaufen. Der Ausgangspunkt dieser Transzendierung liegt dabei durchaus in einem phänomenalen Zusammenhang, der auch empirischen Untersuchungen zugänglich ist (und es wäre eine eigene Betrachtung erforderlich, um aufzuweisen, wie die Plausibilität der Derridaschen Dekonstruktion sich auf eine Erscheinung stützt, die sie als solche verleugnet): Dieser Zusammenhang, auf den Derrida in seiner Argumentation stets rekurriert, ist in Saussures Beobachtung ausgedrückt, dass es in der Sprache (langue) keine positiven Einzelglieder gibt, sondern immer nur Beziehungen und Differenzen mit anderen Elementen. Wie Saussure – bezeichnenderweise am Beispiel der Schrift – erklärt, gibt es (1.) keine innere Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem (Arbitrarität), (2.) ist der Wert eines Zeichens negativ und durch Differenz zu anderen Zeichen bestimmt und (3.) spielen für den Wert eines sprachlichen Zeichens die materialen Eigenschaften des Zeichens (Farbe, Laut etc.) keine Rolle: der Wert eines Zeichens bestimmt sich nur aus seiner Stellung in einem differentiellen System.[10]
Derrida übernimmt dieses Theorem von der Differentialität der Sprache und radikalisiert es unter dem Titel ‚Schrift‘. Sein Argumentationsgang lässt sich so beschreiben: Wenn ein System notwendig durch Differenzen gebildet wird, während die phänomenalen Einzelglieder ihren Wert erst aus ihrer Stellung in einer differentiellen Ordnung gewinnen, dann sind es primär Differenzen, die ein System konstituieren. Die Differentialität, die dies leistet, ist nun aber in keiner Weise ontologisch positiv zu bestimmen: „Es geht hier nicht um eine bereits konstituierte Differenz, sondern, vor aller inhaltlichen Bestimmung, um eine reine Bewegung, welche die Differenz hervorbringt.“[11] Differentialität als konstituierende Instanz vor aller positiven Bestimmung zu denken, erfordert, sie begrifflich als ein Geschehen zu fassen, das produktiv werden kann. Derrida setzt an dieser Stelle die Begriffe ‚Spiel‘ und ‚différance‘ ein: „In einer Sprache, im System der Sprache, gibt es nur Differenzen. (…) Aber einerseits spielen diese Differenzen: im Sprachsystem (langue), im Sprechakt (parole) und im Austausch zwischen Sprachsystem und Sprechakt. Andererseits sind diese Differenzen selbst wiederum Effekte. Sie sind nicht in fertigem Zustand vom Himmel gefallen (…) Was sich différance schreibt, wäre (…) jene Spielbewegung, welche diese Differenzen, diese Effekte der Differenz, durch das ‚produziert‘, was nicht einfach Tätigkeit ist.“[12] Ohne hier im einzelnen darauf eingehen zu können, wie Derrida durch Konzepte einer verzeitlichten Differentialität dem metaphysischen Substanz- und Subjektdenken jede Grundlage zu entziehen sucht – eine Bewegung, die an dieser Stelle in keiner Weise kritisiert werden soll – ist doch zu bemerken, wie mit ihr eine spezifische Ausblendung verbunden ist. Derridas Verweis auf das Spiel zwischen langue und parole bleibt nämlich ein Lippenbekenntnis. Tatsächlich wird dieses Spiel zwischen System und Akt in Derridas Ausführungen ein um das andere mal eingezogen, in einer Stringenz ausgeblendet, die in der Perspektive einer Philosophie der Praxis ebenso gezwungen erscheint wie die Saussuresche Ausblendung der Schrift in der Grammatologie.[13] Denn vom Spiel zwischen parole und langue behält Derrida, wenige Absätze später, nur das „Schema“, nicht den „Inhalt“ bei und überantwortet sowohl den differentiellen als auch den temporalen Aspekt der konstituierenden Bewegung einer einzigen Instanz, die er hier différance nennt, an anderen Stellen ‚Spur‘ oder ‚Urschrift‘.[14] Entscheidend ist nun, dass Derrida damit Saussures Theorem über seine Grenzen hinaus strapaziert. Denn Saussure legt unmissverständlich klar, dass der Gegenstand seiner Überlegungen die Sprache (langue) und nicht das Sprechen (parole) ist.[15] Was Saussure zur differentiellen Konstitution des sprachlichen Wertes sagt, betrifft somit lediglich das System der langue. Ebenso ist bei Saussure klar, dass „alles Diachronische in der Sprache nur vermöge des Sprechens diachronisch ist. “[16] Denn im Sprechen, also in der parole, ruhe „der Keim aller Veränderung“.[17] Derrida hingegen hebt die Differenz zwischen System und Akt auf, indem er, da die Verwiesenheit von langue und parole aufeinander einen „Zirkelschluß“ impliziere, es als notwendig ansieht, ein beiden zugrunde liegendes Moment auszumachen: „Man muß daher vor jeder Trennung von Sprache und Sprechen … eine systematische Produktion von Differenzen – eine différance – annehmen, aus deren Wirkung man eventuell durch Abstraktion und, indem man bestimmten Motivationen folgt, eine Linguistik der Sprache und eine Linguistik des Sprechens herausschneiden können wird.“[18] Damit wird das Spiel zwischen System und Akt in ein umfassender Systematisches verlagert. Das Motiv für diesen argumentativen Schachzug geht aus dem Kontext klar hervor: Es geht darum, dass kein „Subjekt, das Agent, Autor oder Herr der différance wäre“ existiert, dass vielmehr „Subjektivität – ebenso wie Objektivität – eine Wirkung der différance“ sei.[19] Mein Ziel hier ist nun nicht, durch ein Insistieren auf die Differenz von langue und parole die Instanz eines autonomen Subjekts oder eines schlechthin gegebenen Objekts zu rehabilitieren. Es geht mir vielmehr darum, auf der Differenz zwischen langue und parole zu bestehen, um den Ort, an dem im Verhältnis zwischen System und Akt Spannungen zu Abweichungen, Korrekturen, Scheitern, Neuerung führen können, für die Theorie zu sichern. Dazu ist es erforderlich, eine strukturelle Implikation herauszustellen, die in Saussures Theorem angelegt ist und die in Derridas Aufgreifen dieses Theorems universalisiert wird: die von Saussure postulierte Arbitrarität und Differentialität des Zeichens bedeutet, dass der Wert des Zeichens, durch die Beziehungen, in denen es steht, konstituiert wird. Dieses In-Beziehung-Stehen, sein Unterschiedensein von und sein Bezogensein auf andere Zeichen, definiert den Wert eines Zeichens, ohne dass eine in ihm liegende substantielle oder materiale Wesenheit oder eine notwendige oder kausale Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem erforderlich wären. Derrida versucht nun, diese Vorgängigkeit der differentiellen Relation dadurch zu radikalisieren, dass er das Zeichen zusätzlich durch eine elementare Struktur der Wiederholung („Iterierbarkeit“[20]), was impliziert: durch seine Herauslösbarkeit und Einsetzbarkeit in andere Kontexten charakterisiert.
In der Betonung „der Möglichkeit des Heraushebens oder zitationellen Pfropfreises, die zur Struktur eines jeden gesprochen oder geschriebenen Zeichens (marque) gehört“[21] schleicht sich nun aber eine Harmlosigkeit in Derridas Philosophie ein, die dort kaum vermutet wird. Denn was hier mit dem Wort ‚Möglichkeit‘ beschrieben wird und was als solche impliziert, dass das Zeichen stets nur aus seinem In-Beziehung-Stehen in einem kontextuellen System heraus und in ein In-Beziehung-Stehen in einem anderen kontextuellen System hinein gerückt werden würde, das ist in actu die Arbeit und das Wagnis der parole. Jeder Sprechakt, so ist gegen Derrida einzuwenden, steht nämlich in der Aufgabe, in Beziehung zu setzen, was noch nicht in Beziehung steht. Die paradigmatischen differentiellen Bestimmungen der Zeichen als Elemente der langue sind der parole nicht positiv gegeben, die langue enthält keine universalen Muster, die lediglich konform zu wiederholen wären.[22] Vielmehr gehört es zur strukturellen Bestimmung der parole, dass niemals mit letzter Sicherheit feststehen kann, welche Folge von Zeichen in welcher Nuancierung welchen Sprechakt ergeben. Das elementar prekäre Moment, das übrigens dem Verstehen genauso wie dem Sprechen, dem Lesen wie dem Schreiben inhärent ist, das also den Akt des Zeichengebrauchs als solchen betrifft, macht sich in den gewohntesten und am besten eingespielten Situationen am wenigsten bemerkbar. Doch sobald an den ‚normalen‘ Verhältnissen, die Voraussetzung der – mit Wittgenstein gesprochen – „normalen Fälle des Gebrauchs“[23] sind, sich auch nur eine Kleinigkeit verschiebt, wird das prekäre Moment merklich, in dem sich die Akte des Redens, Schreibens und Verstehens ohne feste Bindung an vorgegebene Muster aussetzen und im Modus der Vermutung, der Ahnung oder aus eigener Logik fortsetzen bis sie – im Falle des Gelingens – sich als gleichsam ‚sinnvolle Verläufe‘ vollenden.[24] Die Arbeit der Artikulation und die Arbeit des Verstehens, das Wagnis der Formulierung und der Auffassung, die stets damit verbunden sind, implizierte Ansprüche und Konsequenzen aufzunehmen, diese Aspekte, die dem „Spiel der Welt“[25] seine Tiefe und Ernsthaftigkeit geben, werden ausgeblendet, wenn die kategoriale Differenz zwischen langue und parole eingeebnet oder unterlaufen wird. Denn die Struktur des sinnhaften Aktes unterscheidet sich von einer Selbstartikulation des Systems dadurch, dass er sich nicht einfach nur artikuliert, sondern sich im Artikulieren, in der Einrichtung und Nuancierung von Zeichen in Beziehung setztzu den Ketten von Elementen, mit denen die eingesetzten Elemente in systematischer Beziehung stehen. Der parole (hier als Name gebraucht für jeden sinnhaften Akt) ist deshalb selbst in den unscheinbarsten Akten ein Moment qualitativer Überschreitung eigen, in dem nicht nur Zeichen und Kontexte verschoben und umarrangiert werden, in dem vielmehr ‚Sinnordnungen‘ aus eigenem Recht entstehen können.
Der parole ein Moment des Neuansatz, der qualitativen Produktivität zuzuschreiben, scheint hinter das kritische Programm der Grammatologie zurückzufallen, scheint Ursprung und Gesetz dort wieder einführen zu wollen, wo solche metaphysischen Konzepte glücklich überwunden sind. Doch das ist nicht der Fall. Es geht nicht darum, mit dem Sprechakt die Autonomie des Subjekts zu rehabilitieren, nicht darum, ein Moment des Ursprungs zu retten, aus dem sich ein Gesetz des Verlaufs ableiten ließe, Aufgabe ist vielmehr, aus der Logik auszubrechen, in der Derrida eine negative Metaphysik in die positive einschreibt mit dem Ziel, sie auszuhöhlen, ihre Zuflüsse auszutrocknen, aber zugleich mit dem Effekt, dass er strukturanaloge Universalbegriffe in Anschlag zu bringen hat, die das Feld der Metaphysik besetzen und übernehmen können. ‚Hohl‘ und ‚ausgetrocknet‘, leblos mag manchem erscheinen, was dieser intellektuelle Kraftakt hinterlassen hat. Die grammatologische Dekonstruktion konnte das prekäre Spiel zwischen langue und parole, in dem Setzung unter Bedingungen von Unterbestimmtheit sich vollzieht, nicht denken, da ihre Bewegung allem Gesetzten – als zeitlos-stabile Entität identifiziert – ein elementares Verwiesensein, ein Entzug von Identität entgegensetzte. Das thetische Moment der parole aber führt auf keinen Ursprung, keinen zeitlos-stabilen Grund zurück. Es ist setzend gerade insofern es ausgesetzt ist. Insofern jede Vorlage, jedes Muster, jede Form gegenüber einer aktuellen Handlungssituation unterbestimmt ist (mehr oder weniger – abhängig von Normalität und Geläufigkeit der Situation), bildet sich im Akt etwas heraus, was – in geringerem oder größerem Maße – neu ist in der Welt.
Wenn diese Darstellung hinreicht um anzudeuten wie Schrift aus der strategischen Operation der Metaphysikkritik befreit werden kann, indem nämlich die tendenziöse Ausblendung der aktualen Realisierung revidiert wird, dann öffnet sich der Raum für die Frage, welchen Einfluss die spezifischen Strukturen von Schrift im Lesen und Schreiben haben und wie sich diese Einflussfaktoren unterscheiden von denen, die in anderen medialen Aktualitäten, z. B. denen der gesprochenen Sprache oder des Bildes manifestieren.
[1] Derrida, Jacques, „Signatur. Ereignis. Kontext“, in: Randgänge der Philosophie, Frankfurt/ Main, Berlin, Wien, 1976, S. 124-155, hier S. 129.
[2] Ebd., S. 134.
[3] Flusser, Vilém, Die Schrift. Hat Schreiben Zukunft? Frankfurt/Main, 1992, S. 10.
[4] Kittler, Friedrich, „Es gibt keine Software“, in: ders., Draculas Vermächtnis. Technische Schriften, Leipzig, 1993, S. 225-242, hier S. 226.
[5] Vgl. dazu: Krämer, Sybille, Symbolische Maschinen. Die Idee der Formalisierung in geschichtlichem Abriß. Darmstadt, 1988. Und: Heintz, Bettina, Die Herrschaft der Regel: Zur Grundlagengeschichte des Computers, Frankfurt/Main, New York, 1993.
[6] Geier, Manfred, „Schriftlichkeit und Philosophie“, in: Hartmut Günther, Otto Ludwig (Hg.), Schrift und Schriftlichkeit / Writing and Its Use. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung, Bd. 1, Berlin, New York, 1994, S. 646-654, hier S. 652.
[7] Goodman, Nelson, Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie, Frankfurt/Main, 1995.
[8] Vgl. Fischer, Martin, „Schrift als Notation“, in: Peter Koch, Sybille Krämer (Hg.), Schrift, Medien, Kognition. Über die Exteriorität des Geistes, Tübingen, 1997, S. 83-101. Vgl. auch den Beitrag von Christian Stetter in diesem Band. Symptomatisch für den Stand der Debatte, die sich in der Gegenüberstellung eines lautsprachenbezogenen und eines notationalen Schriftbegriffs verfangen hat, ist auch, dass Rainer Totzke in der Begründung seines ‚engeren‘, sprachbezogenen Schriftbegriff lediglich eine Alternative sieht, nämlich die eines notationalen, an Goodman orientierten Schriftbegriffs, den er aber für seine Fragestellung nach den spezifischen Wirkungen und Konsequenzen des Einsatzes von Schrift wohl als wenig aufschlussreich erachtet. Vgl. Totzke, Rainer, Buchstaben-Folgen. Schriftlichkeit, Wissenschaft und Heideggers Kritik an der Wissenschaftsideologie, Weilerswist, 2004, S. 55 f. Warum ein Schriftbegriff, der Schrift mit Notationalität identifiziert, zugleich zu eng und zu weit ist, wird erläutert in: Kogge, Werner, „Denkwerkzeuge im Gesichtsraum. Schrift als Kulturtechnik“, in: Moritz Wedell, Pablo Schneider (Hg.), Grenzfälle: Transformationen von Bild, Schrift und Zahl, Weimar, 2003, S. 19-40.
[9] Derrida, Jacques, „Signatur. Ereignis. Kontext“, a.a.O., S. 137.
[10] Saussure, Ferdinand de, Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, 2. Aufl., Berlin, 1967, S. 142 f. Vgl. dazu: Derrida, Jacques, Grammatologie, Frankfurt/Main, 1983, S. 91 f.
[11] Derrida, Jacques, Grammatologie, a.a.O., S. 109.
[12] Derrida, Jacques, „Die différance“, in: ders., Randgänge der Philosophie, Frankfurt/Main, Berlin, Wien, 1976, S. 6-37, hier S. 16 f.
[13] Derrida, Jacques, Grammatologie, a.a.O., S. 79 f.
[14] Vgl. Derrida, Jacques, Grammatologie, a.a.O., S. 98-114.
[15] Saussure, Ferdinand de, Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, a.a.O., S. 23 f.
[16] Ebd., S. 117, Herv. im Orig.
[17] Ebd.
[18] Derrida, Jacques, Positionen, Graz, Wien, 1986, S. 69 f.
[19] Ebd., S. 70.
[20] Derrida, Jacques, „Signatur. Ereignis. Kontext“, a.a.O., S. 133.
[21] Ebd., S. 141.
[22] Vgl. ebd., S. 150.
[23] Wittgenstein, Ludwig, Philosophische Untersuchungen, in: ders., Werkausgabe, Bd. 1, 6. Aufl., Frankfurt/Main, 1989, § 142.
[24] Vgl. dazu ausführlich: Kogge, Werner, Die Grenzen des Verstehens: Kultur – Differenz – Diskretion, Weilerswist, 2002, S. 263 ff.
[25] Derrida, Jacques, Grammatologie, a.a.O., S. 88.
